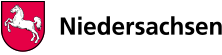- "Ich seh' das so": Erfahrungen - Träume- Sichtweisen
- Editorial 3/ 2001
- "Du Kanackensau!" - Mannschaftskapitäne als Mediatoren auf dem Fußballplatz
- Nette Jungs? Ausländer und Rechtsextremismus auf dem Fußballplatz
- Karin Ridegh-Hamburg: "Viele denken, wir sind einfach Russen"
- Daniel Satra: "Jeder hat sein Kochrezept für's Leben"
- Solveig Vogel: "Gemeinsam erste Schritte in die Freiheit"
- Francesca Ferrari: In der "Deutschen Eiche" isst man griechisch
- Adriane Borger: "Gott hat uns keine Grenzen gesetzt"
- Fred Anders "Die Sache kann sich auch anders entwickeln"
- Netzwerk zur Integration - Die kooperative Migrationsarbeit in Niedersachsen
- Einstieg über die Job-Börse - Was tun, wenn Jugendliche nicht kommen?
- Birgit Loff: Täter suchen Opfer, keine Gegner - Training gegen Gewalt
- Nachrichten Ausgabe 3/2001
- Impressum 3/2001
Karin Ridegh-Hamburg: "Viele denken, wir sind einfach Russen"
Ich heiße Olga Scharf und wurde vor 30 Jahren in der westsibirischen Stadt Nowosibirsk geboren. Dort habe ich 22 Jahre in einem Stadtteil für Akademiker gelebt. Meine Eltern haben als Wissenschaftler gearbeitet. Nachdem sie sich scheiden ließen, ging mein Vater 1991 als erster von uns nach Deutschland. Seine Vorfahren waren Wolga-Deutsche. Meine Mutter ist Russin, blieb noch länger als ich in Nowosibirsk.
Viele Bewohner unseres Wissenschaftsstädtchens dachten in der damaligen Umbruchzeit Russlands ans Ausreisen. Ich schätze, dass ein Drittel von ihnen nach Kanada, USA, Israel oder Deutschland gegangen ist. Bekannte und Freunde von uns sind jetzt in der ganzen Welt verstreut. Aber ich wollte mein Studium der Zahnmedizin abschließen und erst dann gehen. Wir wohnten in einer kleinen Hochhauswohnung, während die wirtschaftliche Situation immer schlechter wurde. 1993 war es dann endlich so weit: Ich hatte mein Diplom in der Tasche.
Mit meiner Ausreise habe ich viele Hoffnungen verbunden. Ich dachte, dass ich in Deutschland in meinem Beruf mehr Chancen haben werde – und eine höhere Lebensqualität. Tatsächlich war hier auch alles sauberer und schöner als bei uns. In der ersten Zeit bin ich viel mit dem Auto umhergereist. Doch die Trennung von meiner Familie war viel schmerzlicher, als ich mir vorgestellt hatte. Meine Mutter war ja zunächst mit ihrer ganzen Familie in Russland geblieben. Wir haben zwar jede Woche miteinander telefoniert und uns auch manchmal gegenseitig besucht, aber es war trotzdem sehr schwer.
Andererseits war mein Vater auch ein Grund gewesen, weshalb ich nach Deutschland ausreisen wollte. Er hat mir vermittelt, dass das Deutsche sehr wichtig ist. Zum Beispiel war auch in meinem russischen Pass als Nationalität "Deutsch" angegeben.
Als ich 1993 nach Deutschland kam, habe ich zuerst bei ihm in Osnabrück gewohnt. Er hat mir auch geholfen, hier die ersten Schritte zu machen und die Berge von Papieren zu bewältigen. Besonders das erste halbe Jahr war für mich hier sehr problematisch, weil ich ja kein Wort Deutsch konnte. Ob zum Einkaufen oder zu Ämtern – ich musste immer mit meinem Vater oder meinem früheren Mann dort aufkreuzen. Er stammt aus meiner Heimatstadt Nowosibirsk, aber ich habe ihn kurz nach meiner Ankunft in Deutschland kennen gelernt. Ein Jahr lang habe ich dann einen Sprachkurs bei der Volkshochschule besucht, der von der Otto-Benecke-Stiftung finanziert wurde. Danach konnte ich mich schon besser verständigen.
Noch während des Sprachkurses wollte ich mein russisches Diplom der Zahnmedizin anerkennen lassen. Da hieß es, ich müsse aber erst ein zweijähriges Anpassungspraktikum bei einem Zahnarzt machen. Ich hatte auch schnell eine Stelle gefunden, aber inzwischen auch geheiratet. So zog ich fünf Monate später mit meinem Mann nach Heilbronn, weil er dort einen Studienplatz bekam. Im November 1994 wurde meine Tochter Tanja geboren und meine Mutter zog zu uns nach Deutschland, um auf das Kind aufzupassen. Jetzt konnte ich endlich ein neues Praktikum anfangen – doch leider: inzwischen hatten sich die Bedingungen geändert. Ich durfte jetzt nur noch als "Entlastungs-Assistentin" eingestellt werden, was automatisch hieß, dass ich keinen Zahnarzt finden würde. Denn dieser Arzt hätte ausreichend Patienten für zwei Ärzte haben müssen. Wer aber hat in der heutigen Zeit schon so viele Patienten und wer will jemanden einstellen, der noch keine Erfahrung in Deutschland hat ?
Nach einem halben Jahr in Heilbronn brach mein Mann sein Studium ab und wir gingen im Sommer 1996 nach Lüneburg.
Es hat mich damals sehr geärgert, dass ich mit meiner fünfjährigen abgeschlossenen Berufsausbildung hier nichts anfangen konnte. Die neuen Bedingungen hatten es fast unmöglich gemacht, in den Beruf hineinzukommen. Bis 1993 wäre es als Ausbildungs-Assistentin viel einfacher gewesen. Aber damals hatte ich andere Sorgen. Meine Ehe ging nicht so, wie ich mir das gewünscht hatte, und da war ja auch noch unser Kind. Bald wusste ich auch, dass ich wohl nicht mehr lange mit meinem Mann zusammenleben würde. Schließlich fiel mir wieder ein, dass ich in Russland während meines Studiums Nachtwachen im Krankenhaus gemacht habe. Also bewarb ich mich hier um einen Ausbildungsplatz als Krankenschwester. 1997 habe ich meine Lehre im Niedersächsischen Landeskrankenhaus begonnen. Übrigens hat mir die Bezirksregierung verweigert, meine Ausbildungszeit aufgrund meines Medizin-Studiums zu verkürzen. Man hat mir das einfach nicht zugetraut. Dabei habe ich meine Ausbildung im Oktober 2000 gut abgeschlossen.
Nach der Trennung von meinem Mann, bin ich 1998 mit meiner Mutter zusammengezogen. So konnte sie auch auf meine Tochter aufpassen. Für meine Mutter war der Einstieg in Deutschland noch schwieriger als für mich. Weil sie Ausländerin ist, erhielt sie weder Unterstützung noch wurde ihr ein Sprachkurs finanziert. So ging sie putzen und kellnern. Schließlich hat sie dann beim Deutschen Roten Kreuz einen Altenpflegekurs gemacht und arbeitete zwei Jahre als Pflegerin – was ihrem Stand als Wissenschaftlerin jedoch keineswegs entsprach. Unser nächster Versuch: wir gründeten ein kleines russisches Geschäft. Doch auch das schlug fehl. Denn wir hatten so wenig Einnahmen, dass wir es nach sechs Monaten wieder schließen mussten. Meine Mutter konnte dann über das Arbeitsamt eine Umschulung zur Programmiererin in Hamburg machen und ich habe eine Anstellung als Krankenschwester in der Abteilung für septischen Chirurgie des Städtischen Klinikums in Lüneburg angenommen.
Es gefällt mir dort gut. Ich bin ein Mensch, der nicht so leicht unterzukriegen ist. Ich bin ziemlich stresssicher, deswegen ist es für mich auch nicht so anstrengend. In der letzten Zeit fällt mir auf, dass die Patienten in zwei Klassen aufgeteilt werden: in die Privatversicherten und die allgemeine Klasse. Ich finde das einfach ungerecht und unterscheide da nicht.
Die Gesellschaft hier trenne ich in zwei Generationen: die älteren Menschen, die den Krieg und die Nachkriegszeit erlebt haben, sind für mich angenehmer. Sie erzählen gern aus ihrem Leben und haben auch Verständnis für die Russland-Deutschen. Für sie ist auch die Nationalität noch wichtig. Die unter 40-Jährigen sind mehr materialistisch eingestellt. Sie sind oft berechnend und bauen nur Beziehungen auf, die ihnen nützlich sein könnten.
Ich empfinde es auch so, dass es unter den Menschen an Herzlichkeit und Offenheit gegenüber anderen fehlt. Dennoch habe ich viele deutsche Freunde und bin auch von meinen Kolleginnen gut aufgenommen worden. Na ja, manche Fremde werden auch mal komisch, wenn sie meinen harten Akzent hören, aber das nehme ich mir nicht zu Herzen. Alles hängt doch sehr davon ab, wie man auf die Menschen zugeht. Ich stehe dazu, aus Russland zu kommen, und versuche die Leute aufzuklären, was Aussiedler eigentlich sind. Das wissen viele nämlich gar nicht, sie denken, wir sind einfach Russen. Es fehlt an Aufklärungsarbeit.
Und jetzt sollen also qualifizierte Kräfte aus dem Ausland kommen. Ich finde, man sollte lieber die eigenen Landsleute qualifizieren, Umschulungen anbieten und in der Schule mehr darüber aufklären, welche Berufe für den Staat notwendig sind. Die meisten Kinder sind doch lenkbar. Mehr Ausländer bringen auch mehr Identitäts-Probleme für die Jugend – für Deutsche wie für Ausländer. Ich stehe immer noch zwischen zwei Welten. Ich lebe zwar hier, aber ein Teil in mir zieht mich nach Russland. Wenn hier aber jemand "Russin" zu mir sagt, bin ich gleich an der Decke. Die Familien müssten in Deutschland mehr gefördert werden, dann gäbe es auch mehr Kinder. Man sollte versuchen, erst einmal selber mit den Problemen klar zu kommen, bevor man Fremde holt. Für die Ausländer und Aussiedler, die schon hier sind, müsste allerdings vieles erleichtert werden. Die Bedingungen für Aussiedler bis 1993 waren ganz gut. Sie haben sich schneller integrieren können als die, die später gekommen sind. Das Wichtigste ist, die Sprache richtig zu erlernen, deshalb müssrten die Sprachkurse und die Hilfen wieder verlängert werden.
Ich bin jetzt sehr zufrieden. Letztes Jahr habe ich meinen Traummann kennen gelernt – ein richtiger Lüneburger! Anfang Juli haben wir geheiratet und sind zusammen nach Russland geflogen. Bald wollen wir auch ein eigenes Haus bauen – mit Garten. Darin kann ich mich dann "selbst verwirklichen". Denn Pflanzen und Gärtnern sind meine große Leidenschaft. Ich möchte mich auch beruflich noch weiter entwickeln. Es gibt ein vierjähriges Pflegestudium, das mich sehr interessiert... mal sehen ... ich habe noch keine konkreten Vorstellungen darüber, wie ich das mache. Vielleicht beginne ich es als Fernstudium, denn wir möchten gern noch zwei Kinder haben.
Das Gespräch führte Karin Ridegh-Hamburg, freie Journalistin in Lüneburg