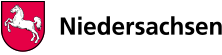- Editorial
- Gewalt zwischen Macht und Ohnmacht
- Ein Junge weint doch nicht
- Spurensuche
- Einmischen oder raushalten?
- Was soll ich in Dortmund?
- Wer fordert, muss auch fördern
- Ich wollte schon immer Polizist werden
- Integrationsberater
- Gemeinsam füreinander aktiv
- Verletzlichste Opfer
- Nachrichten 2/2002
- Zwischen Macht und Ohnmacht
Dr. Haci Halil Uslucan: Gewalt zwischen Macht und Ohnmacht
Die Gewalterfahrung – als Täter wie als Opfer, im Tun wie im Erleiden, im Macht- oder Ohnmachtserleben – ist zunächst jenseits ihrer moralischen Wertung vor allem eine extreme, bisweilen rauschhaft sinnliche Erfahrung. Wer also Gewalt erkunden und beschreiben will, kann auf eine kurze Analyse des Schmerzes nicht verzichten.
Schmerz zählt zu den spezifischen Gewalterfahrungen. Die Zusammenhänge zwischen Macht bzw. Ohnmacht, Schmerz und der Sprache sind offensichtlich. Wachsender Schmerz entzieht uns die Steuerbarkeit unseres psychischen und körperlichen Seins; wirft uns ohnmächtig zurück auf bloße Kreatürlichkeit und Instrumentalität; im radikalsten Fall auf eine Eigenmächtigkeit des Körpers, der "neben" uns zu stehen scheint. Der Schmerz, so schreibt E. Scarry in ihrem Buch "Der Körper im Schmerz. Die Chiffren der Verletzlichkeit und die Erfindung der Kultur", verfügte über ein enormes Widerstandspotenzial gegen die Sprache. "Was immer der Schmerz bewirken mag, er bewirkt es zum Teil durch seine Nichtkommunizierbarkeit. Dies bestätigt sich darin, dass er sich der Sprache widersetzt."
Und weiter: "Der körperliche Schmerz ist nicht nur resistent gegen Sprache, er zerstört sie; er versetzt uns in einen Zustand zurück, in dem Laute und Schreie vorherrschen, deren wir uns bedienten, bevor wir sprechen lernten." Genau genommen entzieht sich der Schmerz auch der Empathie; die Leiden des anderen kann ich nicht teilen; das Opfer erfährt eine radikale Vereinsamung. Vielleicht liegt auch darin die nach wie vor herrschende Gleichgültigkeit gegenüber dem Leiden des Gewaltopfers.
Quadratur des Kreises
Migration bedeutet dramatische kulturelle und soziale Veränderungen, die oft zu Stress, Destabilisierung und Überforderung führen. Das gilt besonders für Migranten aus dem orientalischen Raum. Wesentlich häufiger als Einheimische geraten sie in ihrem sozialen Alltag in uneindeutige Situationen, in denen ihre ursprünglich erlernten Handlungsformen versagen. Solche Verunsicherungen und Gefährdungen persönlicher Orientierung können auch in Rückzugsverhalten, einem starrem Festhalten an eigenen Werten und Normen und in defensiven Erziehungsvorstellungen und- praktiken nach innen (innerfamiliär) und aggressiven Selbstbehauptungsversuchen nach außen münden.
Zwar bringt jeder Wechsel des ökologischen Kontextes für den Menschen stets eine Portion Stress und Belastung mit sich; in diesem Sinne müssten sich also auch Franzosen oder Holländer in Deutschland neu orientieren. Aber Migranten z.B. aus der Türkei, die größtenteils dörflich-agrarischen Verhältnissen entstammen, müssen das weit schwierigere Problem lösen: neben dem technologisch-zivilisatorischen Entwicklungsgefälle haben sie auch die symbolisch-kulturelle Verschiedenheit (Sprache, Religion, Werte) zu verarbeiten und geraten dadurch eben häufiger in uneindeutige Situationen.
Sie fühlen sich viel stärker ohnmächtig den Anforderungen ihrer sozialen Umwelt ausgesetzt, erleben Alltag eher als bedrohlich. Die Balance zwischen dem Eigenen und dem Fremden zu halten, ist für sie eine große Herausforderung. Denn zuviel Wandel und Aufgeben des Eigenen führt zu Chaos, zu wenig Wandel zu Rigidität. Die Integration nach innen (Erhalten von Tra- ditionen) und die Öffnung nach außen erscheinen so oft als Quadratur des Kreises.
Stress und Bewältigung
Möglicherweise ist Gewalt – sei sie innerfamiliär gegen die eigenen Kinder oder den Ehepartner gerichtet, sei sie nach außen gegen Mitmenschen gerichtet – ein Ausdruck des Misslingens dieser schwierigen Syntheseleistungen. Die Belastungen, die sich aus subjektiven Fremdheitsgefühlen und objektiven Ausgrenzungen speisen, führen psychologisch vielfach zu Stress und Verunsicherung. Dann weicht das Gefühl der Herausforderung, das sonst die Begegnung mit dem Neuen kennzeichnet, dem Gefühl der Überforderung und ohnmächtigem Ausgeliefertsein. Stress lässt sich als ein mehrstufiger Prozess begreifen, an dessen Beginn die wahrgenommenen Situationsanforderungen und die Einschätzung der Ressourcen, also gefühlte Macht bzw. Ohnmacht über die Situation, stehen. Diese entscheiden darüber, welche Stresseinschätzung man vornimmt, ob man nämlich die Situation als Herausforderung, Bedrohung, Verlust oder Gewinn einstuft. Darauf folgen Bewältigungsversuche, die zum einen auf eine positive Veränderung der Problemlage, zum anderen auf eine Verbesserung der emotionalen Befindlichkeit gerichtet sind.
Wem der Zugang zu gewünschten Handlungsoptionen und -ressourcen verwehrt bleibt, wer die Barrieren der Partizipation am Sozialen stärker spürt, wie es unzweifelhaft für die Vielzahl der Migranten zutrifft, der fühlt sich verunsichert und in der Folge vermutlich überfordert. Denn ein Zuviel an Belastungen trifft auf ein Zuwenig an Ressourcen, weil diese nicht zu bekommen sind. Sogar Gewalt kann dann zur Handlungsoption werden, um Verunsicherung und Überforderung zu reduzieren, Ohnmacht zu überwinden, Aufmerksamkeit zu gewinnen, Status zu sichern oder persönliche Selbstwirksamkeit, d.h. das Gefühl der (möglicherweise illusionären) Macht über eine Situation zu steigern.
Nicht selten widmet sich die Migrantenforschung ihrem Gegenstand, vornehmlich ausländischen Jugendlichen, unter kriminalpolitischen Erwägungen. Dabei entgehen ihr jedoch vielfach die Besonderheiten des Sozialisationskontextes. Von gesellschaftlichen Veränderungen wie etwa der zunehmenden Entsolidarisierung, der Beschleunigung und Individualisierung des Lebens sind gerade Migrantenjugendliche stärker betroffen. Sie müssen nämlich nicht nur wie ihre deutschen Altersgenossen die nachteiligen Auswirkungen dieser Veränderungen bewältigen, sondern auch noch die positiven Aspekte dieser Individualisierung gegen ihre Eltern durchsetzen. Bei ihnen sind Generationen- und Kulturkonflikt miteinander gekoppelt; sie stehen den elterlichen Werten und Normen wesentlich näher als die deutschen Jugendlichen. In türkischen Familien spitzen sich unter Umständen solche Konflikte eher zu bzw. haben schärfere Auswirkungen auf die Beteiligten.
Betrachtet man also die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, so zeigt sich, dass besonders junge Ausländer weit häufiger in Randgruppen aufwachsen als deutsche Jugendliche. Sie sind von sozialer Desintegration also wesentlich stärker betroffen; d.h. die steigenden gesellschaftlichen Gegensätze, die Aufteilung der Lebenswelt junger Menschen in eine "Winner-Loser-Kultur" platzieren sie immer mehr auf die Verliererseite. Das erhöht wiederum für sie das Risiko, sich bei der Bewältigung ihrer spezifischen Entwicklungsaufgaben und persönlicher Krisen devianten Gruppen anzuschließen und somit wieder in den Strudel der Gewalt zu geraten. Studien zeigen: je besser die Integration junger Ausländer erfolgte, desto geringer war die Gewaltrate.
Blindheit gegen Leiden?
Betrachtet man die Ursachen von Gewalt aus entwicklungspsychologischer Perspektive, so lassen sie sich auf die Kurzformel bringen: Gewalt erzeugt weitere Gewalt und geschlagene Kinder werden oft selber zu Schlägern. Nach seriösen Erkenntnissen sind also auch Eltern, die selbst in ihrer Kindheit gehäuft Opfer von Gewalterfahrung waren, ein "Risikofaktor". In der Erziehung ihrer eigenen Kinder sind sie eher geneigt, Gewalt auszu-üben bzw. Gewalt als eine "Normalität" zu verstehen. Denn Kinder, die in innerfamiliären Sozialisationsprozessen die Gewaltanwendung von Eltern erfahren, lernen dabei zugleich auch bestimmte Muster der Konfliktaustragung kennen. Ihnen wird die Unfähigkeit, Konflikte zu akzeptieren bzw. sie auf eine deeskalierende Weise auszutragen, vorgelebt. Noch höher ist das Risiko, selbst in der Erziehung Gewalt anzuwenden, wenn innerhalb der Partnerschaft die Mütter selbst Gewalt erfahren. Demnach stellt das höchste Gewaltrisiko für ein Kind eine Mutter dar, die sowohl als Kind wie auch innerhalb der Partnerschaft Gewalt erfahren hat oder erfährt. Und: Migrantenfamilien tendieren auch in der Fremde eher zur Beibehaltung eines "familiären Kerns"; insofern ist das Risiko für Migrantenkinder, selbst Opfer von Gewalt in der Familie zu werden, wesentlich höher als für deutsche Kinder.
Was sind die langfristigen psychologischen Konsequenzen der Gewalt gegen Kinder? Müsste nicht angenommen werden, dass eigene Leid- und Schmerzerfahrungen für das Leiden an-derer stärker sensibilisieren?
Dem ist leider nicht so. Aufgrund erlebter Misshandlungen in der Vergangenheit herrscht bei ihnen vielfach in ihrer Entwicklung eine Asymmetrie zwischen dem Maß erlittener Gewalt und der Fähigkeit zur Empathie, der Fähigkeit, fremden Schmerz nachzufühlen. Nicht selten ist diese Blockade, diese Blindheit des Gewalttäters gegenüber dem Leiden des Opfers ein Schutzmechanismus, um den eigenen unbewältigten Schmerz nicht wachzurufen und an das Trauma erinnert zu werden. Blindheit für das Leiden des anderen kann dann ein illusionäres Gefühl von Stärke und Unverletzlichkeit vortäuschen, kann die Gefühle der Hilflosigkeit, Angst und Ohnmacht in Zaum halten.
Dr. Haci Halil Uslucan, Fachbereich Psychologie, Otto von Guericke Universität Magdeburg