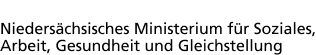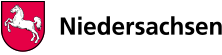- Editorial 1/1999
- PLAKATIVE STAMMTISCHPAROLEN
- Claus Wergin: EHRENAMT: DER EHRE WEGEN?
- Elcin Kürsat-Ahlers: GEGEN DEN STROM
- Matthias Lange: STAATLICH PRODUZIERTE NOT
- Franca Pollano: SECHS STUNDEN TÄGLICH
- Karl-Heinz Janssen: DIE VOLKSHOCHSCHULE - Partner für Engagement
- Beate Winkler: GEGENSTRATEGIE
- GRAZIELLA BOARA-TITZE: "Ich will kein Geld, aber Anerkennung"
PLAKATIVE STAMMTISCHPAROLEN
Ist die geplante Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Tisch? Swanntje Düsenberg im Gespräch mit Gabriele Erpenbeck
Der Tiefflug der CDU über die deutschen Stammtische habe sich gelohnt, so kommentierte bereits nach den ersten Hochrechnungen ein Wahlanalytiker den sich abzeichnenden Sieg der CDU bei den hessischen Landtagswahlen. Nun wisse man auch für die Zukunft, auf welchem Niveau Wählerstimmen errungen werden können. Und auch der designierte hessische Ministerpräsident Koch gab – eine halbe Million Unterschriften gegen die geplante Reform des Staatsangehörigkeitsrechts allein aus Hessen im Gepäck – bereits vor dem Wahltag zu Protokoll, er glaube, dass sich die Kampagne der CDU positiv auf das Wahlergebnis auswirken werde. Aus Sicht der CDU traf diese Hoffnung ins Schwarze: die Christdemokraten in Hessen lösen zusammen mit der FDP die rot-grüne Regierung ab.
Von Anfang an hatte die geplante Reform hitzige Debatten überwiegend jenseits jeder Sachlichkeit erzeugt. Die Hinnahme der doppelten Staatsbürgerschaft hieß für viele: doppelte Rechte für die Ausländer in Deutschland. Die Unterschriftenkampagne der CDU gab diesen Ängsten eine neue Plattform. Viele unterstellten der Partei, sie hätte es bewusst darauf angelegt und gezielte Desinformation betrieben, mindestens aber kein Argument bemüht, sie auszuräumen – weder auf Bundesebene noch an den Unterschriftenständen in den Fußgängerzonen. Da kochte Volkes Seele pur und verhinderte jede Form der konstruktiven Auseinandersetzung und damit auch die sachliche Diskussion über die Punkte der geplanten Reform, die durchaus als strittig angesehen werden konnten. Jetzt sind die Karten neu gemischt: Ist die Reform damit vom Tisch? Und wie wirkt sich das hessische Wahlergebnis und die Unterschriftenaktion auf die Mehrheiten, aber auch auf die Minderheiten in Deutschland aus? Betrifft sprach darüber mit der Niedersächsischen Ausländerbeauftragten Gabriele Erpenbeck.
Red.: Frau Erpenbeck, bevor wir zusammen über das Reformvorhaben sprechen, möchte ich Sie bitten, uns ganz kurz die jetzige Gesetzeslage zu beschreiben.
Erpenbeck: Das will ich gern tun. Erstens gilt das Abstammungsprinzip, aus dem sich die jeweilige Staatsangehörigkeit ableitet. Besitzen Vater oder Mutter oder einer von beiden den deutschen Pass, so erwirbt das Kind die deutsche Staatsangehörigkeit durch Geburt. Ist dies nicht der Fall, ist das Kind wie seine Eltern Ausländer.
Red.: Aber hier lebende Ausländerinnen und Ausländer können sich doch auf Wunsch einbürgern lassen?
Erpenbeck: Unter gewissen Bedingungen selbstverständlich. Nach 10 Jahren Aufenthalt in Deutschland, bei vorhandener Geschäftsfähigkeit, eigener Wohnung und straffreiem Lebenswandel sowie der "freiwilligen und dauernden Hinwendung zu Deutschland", wie es so schön heißt, ist das möglich. Sind hier lebende Ausländerinnen und Ausländer mit Deutschen verheiratet, verkürzt sich diese Frist auf drei bis fünf Jahre. Legt man die erleichterte Einbürgerung nach dem derzeit geltenden Ausländerrecht zu Grunde, gibt es auch noch in anderen Fällen Fristverkürzungen und andere vereinfachende Voraussetzungen.
Red.: Dann ist bislang die Mehrstaatigkeit ausgeschlossen?
Erpenbeck: Durchaus nicht. Es gilt aber der Grundsatz, sie möglichst zu vermeiden, auch wenn sie schon jetzt bei immerhin 20 bis 25% der Einbürgerungen hingenommen wird. Mehrstaatigkeit entsteht zum Beispiel auch immer bei Kindern aus bi-nationalen Ehen, da jedes Elternteil seinen "Pass" vermittelt.
Red.: Und was war nun das revolutionäre an der beabsichtigten Regelung?
Erpenbeck: Revolutionär? Na, ich weiß nicht... eher überfällig. Aber im Ernst: Die Wohnbevölkerung und das Staatsvolk sollten so weit wie möglich identisch sein. Ein Ziel, dass sich auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts findet. Schon jetzt erfüllt etwa die Hälfte aller in Deutschland lebenden Ausländerinnen und Ausländern zumindest die zeitliche Voraussetzung für die Einbürgerung, die Einbürgerungsquote ist aber tatsächlich sehr gering, in Niedersachsen etwa nur 3,5%. Deshalb sah der Arbeitsentwurf vor, das Abstammungsprinzip durch das Territorialprinzip zu ergänzen. Ich sage das so betont, weil viele meinen, das eine solle das andere ersetzen. So ist das aber nicht. Hier soll nur der Grundsatz, die Mehrstaatigkeit zu vermeiden, aufgegeben werden. Ziel der Reform bleibt es, die Einbürgerung zu erleichtern und zu vereinfachen, ohne die doppelte Staatsbürgerschaft tatsächlich anzustreben. Diese Ziele kann ich nur unterstreichen.
Red.: Wenn die Sache so ist – wie kann man dann die ganze Aufregung verstehen?
Erpenbeck: Ich glaube nicht, dass die Mehrheit der einheimischen Bevölkerung wirklich verstanden hat, warum wir eine neue Einbürgerungspolitik brauchen und warum die Hinnahme der Mehrstaatigkeit nicht bedeutet, "gerade den Ausländern" Privilegien einzuräumen.
Red.: Dann sagen Sie doch mal, warum!
Erpenbeck: Sehr gerne. 1. Die Staatsangehörigkeit ist nicht Voraussetzung für gesellschaftspolitische Beteiligung, sondern für die Ausübung der Bürgerrechte und für Gleichberechtigung. Beides ist überfällig! 2. sage ich: Nur auf der Basis gleicher Rechte ist der Kampf um Gleichbehandlung aussichtsreich zu führen. Und schließlich 3. Gleichberechtigung führt zwangsläufig zu mehr gesellschaftlicher Beteiligung. Und sehen Sie – wenn alle Integration wollen, dann kann das schlussendlich nur unter dem Vorzeichen der Gleichberechtigung gehen.
Red.: Die CDU hat sich ja vor kurzem auch sehr klar für die Integration ausgesprochen.
Erpenbeck: Ich bin natürlich froh, wenn jetzt überall auf Integration gesetzt wird. Eine Unterschriftenkampagne in dieser Form ist aber kontraproduktiv. Wie soll die Basis, also die Leute an den Aktionstischen vor Ort, die Informationen komplett, richtig und differenziert in die Diskussionen einbringen können? Nein, ich fürchte, das geht unter den gegebenen Umständen gar nicht. Dafür waren schon viel zu viele Emotionen und Halbwahrheiten hochgekocht.
Red.: Zum Beispiel?
Erpenbeck: Zum Beispiel, dass der Familiennachzug dann leichter wird und Hunderttausende dieses ausnutzen würden. Das ist Unsinn. Ob deutscher oder ausländischer Pass: im Prinzip gilt: nur Ehegatten und minderjährige Kinder dürfen nachziehen. Dabei soll es auch ganz offensichtlich bleiben. Aber wenn ich noch einmal auf den Integrationsgedanken zurückkommen darf...
Red.: ...natürlich...
Erpenbeck: Sie haben auf der einen Seite die soziale und kulturelle Integration – also Ausbildung, Arbeit, Wohnen. Das muss praktisch im wesentlichen in den Städten und Gemeinden laufen. Auf der anderen Seite gibt es die rechtliche Integration. Das heißt die Aufenthaltsverfestigung – von der Aufenthaltserlaubnis über die Aufenthaltsberechtigung bis zur Einbürgerung. Um diesen Prozess geht es bei dem Streit. Am Ende der rechtlichen Integration muss die Einbürgerung stehen. Es geht in Wirklichkeit also um eine Bürgerrechtsdiskussion...
Red.: ... die sicherlich nicht ohne Wirkung auf die Bevölkerung bleibt.
Erpenbeck: Genau. Viele haben das richtige Gefühl, wenn mehr als bisher eingebürgert wird – egal unter welchen Voraussetzungen -, dann ist dass ein unumkehrbarer Prozess. Dann muss die Illusion, oder Lebenslüge, wie manche sagen, aufgegeben werden, ein Großteil der Ausländer würde Deutschland eines Tages freiwillig oder unfreiwillig verlassen. Ich glaube, auch deshalb wird die Diskussion so übermäßig emotional geführt, auch mit plakativen Stammtischparolen, die nun ohne Scham öffentlich geäußert werden dürfen. Dies wiederum schürt erhebliche Ängste auf Seiten der ausländischen Bevölkerung. Diese bekomme ich deutlich zu spüren, wenn mich besorgte Menschen anrufen oder bei Veranstaltungen darauf ansprechen.
Red.: Ist damit die geplante Reform vom Tisch?
Erpenbeck: In der zunächst geplanten Form ist sie offensichtlich nicht mehrheitsfähig. Man wird sich dennoch zusammenraufen, zusammensetzen und modifizieren müssen, denn ein neues und sinnvolles Staatsangehörigkeitsrecht muss neben dem Abstammungsprinzip das Territorialprinzip stärker berücksichtigen. Es muss aber auch weitere Einbürgerungshindernisse z.B. für die sogenannte erste Generation abbauen, die am wirtschaftlichen Erfolg der Bundesrepublik mitgearbeitet hat und jetzt kurz vor dem Rentenalter steht. Würde bei dieser Gruppe Mehrstaatigkeit hingenommen, wäre das auch insoweit unschädlich, als sie diese Staatsangehörigkeiten nicht mehr "vererben" können. Diese Schritte sollten wir tun, wenn es uns ernst ist mit der Integration.
Red.: Frau Erpenbeck, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.