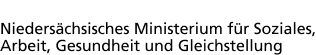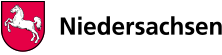Matthias Lange: STAATLICH PRODUZIERTE NOT
Engagement für Flüchtlinge: Das Ehrenamt in der Opposition
Alles spricht bisher dafür, dass die rot-grüne Bundesregierung auf eine gestaltende Asyl- und Flüchtlingspolitik weitgehend verzichten wird. Das hat Auswirkungen auf die Arbeit der Menschen, die sich für Flüchtlinge engagieren, und natürlich auch auf das – insgesamt gesehen weitgehend ungeklärte – Verhältnis von Flüchtlingsarbeit und Ehrenamtlichkeit in diesem Politikfeld.
Zunächst einige Stichworte zu der Entwicklung des Engagements für Flüchtlinge in der Bundesrepublik: Kristallisationspunkte für das Engagement waren staatliche Maßnahmen, die sich unter dem Schlagwort "Abschreckungspolitik" zusammenfassen lassen: So hat die Errichtung von Lagern zur Unterbringung von Flüchtlingen Ende der 70er Jahre (in Niedersachsen ab 1982) dazu geführt, dass sich die ersten "Asyl-Arbeitskreise" zusammenschlossen. Es wurden Deutschkurse organisiert, Gutscheine umgetauscht oder Patenschaften eingerichtet. Erste Ansätze von Lobbyarbeit entstanden – in aller Regel getragen von einem sehr breiten Spektrum engagierter Menschen, die sich zumeist aus kirchlichen, menschenrechtlichen, ökologischen, philanthropischen, politischen oder sozialpolitischen Kontexten heraus zusammenfanden. Im Laufe der Jahre und in Reaktion auf die zunehmende politische und massenmediale Hetze gegen Flüchtlinge (hier war zum Beispiel der Sommer 1986 ein wichtiges Datum) gründeten sich neue lokale Gruppen. Erste Vernetzungen entstanden, Landesflüchtlingsräte und die Bundesarbeitsgemeinschaft Pro Asyl wurden gegründet. Im Zuge der weiteren Entwicklung (Stichworte: die Vereinigung, das neue Ausländergesetz, die rassistischen Übergriffe, der sogenannte Asylkompromiss) erweiterte sich das Spektrum der in diesem Politikfeld engagierten Menschen nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Es entstanden viele dezidiert antirassistische Gruppen und die bisher weitgehend unsichtbaren illegalisierten Flüchtlinge gerieten verstärkt in das Blickfeld der in diesem Politikfeld Engagierten. Verschiedene Kirchengemeinden vernetzten ihr Engagement für die Gewährung von Kirchenasyl, die Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche wurde gegründet. 1997 fand sich ein Spektrum von autonomen und antirassistischen bis hin zu gewerkschaftlichen Gruppen in der Initiative Kein Mensch ist illegal zusammen.
In diesem Politikfeld haben sich von Beginn an auch Flüchtlinge und Migrantinnen und Migranten – allerdings in geringer Zahl – engagiert. Dieses Engagement hat erst in den letzten Jahren zugenommen und sich organisiertere Formen geschaffen. Mit der Karawane für die Rechte von Flüchtlingen, Migrantinnen und Migranten hat es im Sommer 1998 einen ersten Höhepunkt erlebt. Wir haben es hier mit einem Politikfeld zu tun, das zuallererst durch die dras-tische Verschärfung der staatlichen Ausgrenzungs- und Abschreckungspolitik gegenüber Flüchtlingen definiert und geradezu konstruiert worden ist.
Die oppositionelle Rolle
Macht es Sinn, alle diese Formen des Engagements unter dem Stichwort Ehrenamtlichkeit zusammenzufassen? Das ist zumindest nicht unumstritten. Ich möchte hier auf meine persön-lichen Erfahrungen zurückgreifen: Ich bin im Flüchtlingsrat aktiv, dem landesweiten Zusammenschluss der vor Ort engagierten Initiativgruppen und Einzelpersonen. Ich stelle mir vor, ich würde die Mitglieder des Niedersächsischen Flüchtlingsrates fragen, ob sie das Wort "Ehrenamtlichkeit" benutzen, um ihr eigenes Engagement zu beschreiben. Jede Wette, dass ich ziemlich widersprüchliche Reaktionen erhielte. Ihre Spannweite würde mindestens von heftiger Ablehnung bis hin zu selbstverständlicher Zustimmung reichen. Das hat aus meiner Sicht seinen Grund darin, dass jedes ehrenamtliche Engagement in Deutschland zu allererst als ein staatlich anerkanntes Engagement gesehen wird. Dem gegenüber enthält das Engagement für Flüchtlinge in aller Regel eine Haltung der Kritik an der sogenannten Ausländerpolitik. So stehen die im Migrationsbereich ehrenamtlich engagierten Menschen häufig unter politischem Beschuss – entweder von offizieller Seite oder von rechtsextremer Seite oder aus den alltäglichen Lebenszusammenhängen heraus; ein "Beschuss", der – wie eine Fülle von Beispielen zeigt – gefährliche und gefährdende Formen annehmen kann. Die Kommission "Migration" der Deutschen Bischofskonferenz hat jüngst versucht, dem Dilemma des Zusammenhangs von staatlicher Anerkennung und Opposition dadurch gerecht zu werden, indem sie den oppositionellen Charakter des Kirchenasyls relativiert hat. Der entsprechende Absatz aus dieser Erklärung, die in Auszügen in der FR vom 4.12.1998 abgedruckt ist, lautet: "’Kirchenasyl’ ist der Versuch, dem der begründeten Befürchtung nach zu Unrecht abgewiesenen Flüchtling zu seinem Recht zu verhelfen. Es geht um eine Beistandsleistung, die primär tatsächlich gefährdeten Personen den nötigen Schutz gibt und dadurch indirekt ein besseres und gerechteres Flüchtlingsrecht im Einzelfall einklagt. Weder eine Opposition gegen den Staat noch eine Relativierung von dessen Rechtsprechung ist damit angezielt." Die angesprochene oppositionelle Haltung asylpolitischen Engagements kann sich somit mehr oder weniger ausdrücklich äußern. Sie mag mehr oder weniger politisch motiviert sein. Und sie kann – wie die Deutsche Bischofskonferenz – die eigene Oppositionsrolle relativieren, um dann aber im selben Atemzug vom Kirchenasyl als von einer "Beistandspflicht" zu reden. Dieser Beistandspflicht, so die Bischöfe weiter, gehe es darum, "das Flüchtlingen versagte Recht vom Staat einzufordern", so dass das Kirchenasyl "einen Akt der Nothilfe für Flüchtlinge" darstelle. Eine Hilfe in einer Notsituation, die deshalb gebraucht wird, weil der Staat diese Not politisch und administrativ "produziert". Auf der einen Seite liegt hier eine der in der Praxis wohl wichtigsten Fallen von Ehrenamtlichkeit: Wer dort hilft, "wo es am nötigsten ist", der übersieht nur allzu leicht, dass das Ehrenamt auf diese Weise als Ausfallbürge von Politik mobilisiert wird. Beispielhaft dafür sind die medizinischen Unterstützungsprojekte oder auch Gutscheinumtauschinitiativen, auf die mittlerweile bereits verschiedene Sozialämter verweisen, weil sie selbst in einer Notsituation keinen Krankenschein oder kein Bargeld gewähren wollen. Auf der anderen Seite kann diese Nothilfe für Flüchtlinge aus der Erfahrung der konkreten Praxis heraus kaum daran vorbeischauen, dass es sich hier um eine staatlich produzierte Not handelt.
In diesem Zusammenhang ist es erhellend, dass das Kirchenasyl von den beiden christlichen Kirchen Mitte 1997 als ein Engagement bezeichnet wurde, das "einen Beitrag zum Erhalt des Rechtsfriedens und der Grundwerte in unserer Gesellschaft" leistet. Es ist klar: dieser Beitrag kann natürlich nur deshalb geleistet werden, weil dieses Engagement seine Grenze nicht unbedingt dort findet, wo das Gesetz es vorsieht. Denn das Gesetz ist in der offiziellen Asylpolitik und Gesetzgebung genau jene Maschine, die die Not produziert. Entsprechend präzisiert das Gemeinsame Wort der Kirchen zu den Herausforderungen durch Migration und Flucht: "Diejenigen, die aus einem Gewissenskonflikt heraus weitergehen und sich zu einem begrenzten Verstoß gegen bestehende Rechtsvorschriften entschließen, müssen dafür freilich wie bei allen Aktionen des zivilen Ungehorsams auch selbst die Verantwortung tragen." Die Stichworte lauten Gewissenskonflikt und ziviler Ungehorsam. Das Gewissen ist aus der Sicht der Kirchen die Grundlage für die Gewährung von Kirchenasyl. Und ohne irgendeine Form des zivilen Ungehorsams wird es heutzutage wohl kaum möglich sein, "das Flüchtlingen versagte Recht vom Staat einzufordern" – um noch einmal den Satz der Deutschen Bischofskonferenz zu zitieren. Entsprechend stellt der Päpstliche Rat der Seelsorge für Migrantinnen, Migranten und Menschen unterwegs mit klassischer Klarheit fest: "Ausländer, die sich ohne Aufenthaltsrecht im Land aufhalten, ... haben ein Recht auf die Solidarität der Christen. Diese Solidarität macht auch dort nicht halt, wo das Gesetz es vorsieht." (in: Beihefte caritas 1, 1995, S. 32f.)
Ehrenamtlichkeit:
Jede Form des freiwilligen ehrenamtlichen Engagements hat seinen Weg und seine Möglichkeiten, Flüchtlinge zu schützen. Auf diesen Wegen kann zum Beispiel versucht werden, zunächst ihre Integration durch eine Quasi-Legalisierung "von unten" zu erreichen: indem die Lehrerinnen und Lehrer, die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, die Ärztinnen und Ärzte organisiert werden, die bereit und in der Lage sind, ihre Tätigkeitsfelder für Illegalisierte zu öffnen. Indem entsprechende Netzwerke von "Einrichtungen" aufgebaut, Wohnungen und Kirchenasyle organisiert werden. Solch konkrete Arbeit führt dazu, dass Flüchtlingsarbeit "sozialarbeiterisiert" wird. Zugleich aber wird die Flüchtlingsarbeit insgesamt politisiert. Schließlich ist diese Arbeit kaum denkbar, ohne dass ihr eine individuelle politische und/oder Gewissensentscheidung vorausgegangen wäre, die sich ausdrücklich auch mit den politisch gesetzten Grenzen legalen Handelns auseinandergesetzt hat. Wir haben es hier mit einem schon beinahe demokratie theoretisch zu nennenden Dilemma zu tun. Denn allgemein gesprochen bauen die rechtlichen Grundlagen jeder modernen Demokratie auf einer (politisch zu treffenden) Entscheidung darüber auf, was in ihrem Rahmen legal ist und was illegal. Was aber, wenn man eine Antwort auf die Frage sucht, ob es in einer Demokratie überhaupt in jedem Fall legal sein kann, zwischen legal und illegal zu unterscheiden? Kann es, um auf das von Eli Wiesel geprägte Motto der Initiative Kein Mensch ist illegal anzuspielen, legal sein, dass ein Mensch illegal ist? Dieses Dilemma hat wesentliche Auswirkungen auf die konkrete Gestalt der Zwickmühle, in der sich jedes ehrenamtliche Engagement unweigerlich befindet. Denn entweder ist Ehrenamtlichkeit freiwillig und wird zum Beispiel aus Gewissensgründen praktiziert. Dann aber kann sie sich kaum an der Frage des zivilen Ungehorsams vorbeimogeln. Oder Ehrenamtlichkeit wird vom Staat als Pflichterfüllung interpretiert und entsprechend eingefordert.
Die Bedeutung der Kategorie der Freiwilligkeit wird deutlich, wenn wir uns kurz den Hauptstrang der aktuellen Diskussion über Ehrenamtlichkeit anschauen. In dieser Diskussion, wie sie unter Stichworten wie Bürgerarbeit, dritter Sektor, Zivilgesellschaft bzw. Bürgergesellschaft geführt wird, geht es immer auch um die Frage, bis zu welcher Grenze der Staat ehrenamtliches Engagement einfordern darf. In den USA werden die entsprechenden "welfare-to-work"-Programme unter dem Stichwort "workfare" diskutiert. Und Selbsthilfegruppen organisieren sich -wie zum Beispiel in Manhattan – unter dem Titel "workfairness", um ihr Recht auf Freiwilligkeit und Selbstbestimmung einzufordern. Dass workfare auch in der Bundesrepublik eine gängige Praxis ist und unter dem Namen "gemeinnützige Arbeit" Sozialhilfeempfängerinnen und -empfängern zugemutet wird, dürfte bekannt sein. Das Leitmotiv ist hier nicht der aktive Bürger, sondern der Bürger, der im Zweifel zu einem ehrenamtlichen Engagement (zwangs-)verpflichtet werden muss. Wer diese Pflicht nicht erfüllt, wird letztlich als "asozial" kategorisiert und entsprechend behandelt. Die Wahrnehmung gemeinnütziger Pflichten wird hier als die Ehre der Bürgerin und des Bürgers interpretiert und erst ihre Wahrnehmung lässt diese Bürgerin und diesen Bürger zu einem vollwertigen Mitglied der Gemeinschaft werden. Ohne auf diesen Zusammenhang hier näher eingehen zu können möchte ich behaupten, dass die Anerkennung der freiwilligen Ehrenamtlichkeit der aktiven Bürgerin und des aktiven Bürgers dem Staat zur demokratischen Ehre gereichen würde. Die im Ehrenamt verborgene Ehre sollte also im modernen politischen Sinne als die Ehre interpretiert werden, die der demokratische Staat der aktiven Bürgerin und dem aktiven Bürger erweist, indem er sein freiwilliges Engagement anerkennt. Unter Rot-Grün dürfte es jetzt nicht mehr ganz so aussichtslos sein, auch ein dezidiert oppositionelles flüchtlingspolitisches Engagement in Zukunft aus einer legitimierten Situation der gesellschaftlichen Anerkennung heraus betreiben zu können.
Die Gefahr
Die Grünen haben sich in der Koalitionsvereinbarung praktisch jegliche Änderung der Ausländer- und Asylpolitik für die längst überfällige Reform des Staatsangehörigkeitsrechts abkaufen lassen. So wichtig diese Reform ist – zusammengenommen mit dem oben angedeuteten Politikverzicht könnte dies eine fatale politische Dynamik in Gang setzen. Denn es verstärkt sich damit die Gefahr, dass die "Reform des Deutschtums" Hand in Hand geht mit der Befestigung der politischen, sozialen und physischen Trennlinien gegenüber all jenen Migrantinnen, Migranten und Flüchtlingen, die auch zukünftig nicht dazugehören sollen. Jenseits dieser Grenze würde dann eine Politik der Ausgrenzung und des "Ohne" herrschen: Ohne Aufenthaltsstatus, ohne Sozialleistungen, ohne medizinische Versorgung und ohne so weiter. Innerhalb des so umgrenzten staatsbürgerschaftlichen Raums würden ver-stärkt Integrationsmaßnahmen ergriffen werden, die auf die "neuen Bürger" zielen, die insgesamt aber kaum etwas an dem Fortbestand der sozialen und der ökonomischen Unterschiede ändern können. Aber eine Folge wird mit ziemlicher Sicherheit eintreten: Die sozialen und die ökonomischen Unterschiede werden verstärkt als Unterschiede zwischen der ethnischen Mehrheit und den ethnischen Minderheiten uminterpretiert werden. Es könnte sich zu einer Spaltung innerhalb des ehrenamtlichen Engagements im Flüchtlings- und Migrationsbereich entwickeln und dazu, dass dieses Engagement die Flüchtlinge aus den Augen verliert. Hinzu kommt, dass diese Dynamik durch weite Teile der offiziellen Politik noch dadurch befördert wird, dass man sie mit einer Art von Verschwörungstheorie verbindet: Mit einem Szenario, in dem Flüchtlinge nur noch als "Illegale" Platz finden und in dem sie mal als die Opfer und mal als die Agenten organisierter Krimineller auftauchen. Es besteht die Gefahr einer zunehmenden Entsolidarisierung von Migrations- und Flüchtlingsarbeit. Hier gegenzusteuern ist aus meiner Sicht die aktuelle Aufgabe des asyl- und migrationspolitischen Engagements. Ein erster Schritt in diese Richtung könnte darin bestehen, dass es den Engagierten gelingt, eine offizielle Anerkennung gerade auch der oppositionellen Elemente ihres Engagements durchzusetzen. Darüber hinaus brauchen wir in nächster Zukunft eine intensive Debatte über die Möglichkeiten des Zusammenführens aller ehrenamtlich Aktiven, die sich im thematischen Feld von Flüchtlings- und Asylpolitik, von Migration und "ethnischen Minderheiten" freiwillig engagieren.
Dr. Matthias Lange ist Vorsitzender des Niedersächsischen Flüchtlingsrates und Vorstandsmitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft PRO ASYL, Hannover