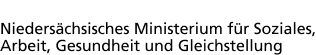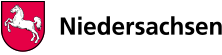- Editorial 2/1999
- Hiltrud Stöcker-Zafari: Politik mit dem Neid
- Swaantje Düsenberg: Alle Kinder sind gleich
- Leonie Herwartz-Emden: "Sie sollen es besser haben"
- Ursula Boos-Nünning: "Zukunft im Blick"
- Manfred Bönsch: Da ist immer noch ein Problem
- Harry Hubert: Lebenswelt im Zentrum
- Kolumne - Verletzte Seelen
- Arzu Altug: "Ich mag Herausforderungen"
- Monika Ruprecht: Konkreter Impuls - Ein Projekt für jede Frau und jeden Mann
- Impressum Ausgabe 2/1999
Ursula Boos-Nünning: "Zukunft im Blick"
Die Lebenssituation von Kindern mit Migrationshintergrund ist oft durch ungünstige Bedingungen gekennzeichnet. Das zeigt sich am Beispiel Wohnsituation. Welche Antworten muss die Politik geben?
Längst nicht jeder und jede – in den Schulen, in den Kommunen oder in den Ministerien – hat realisiert, wie sich die deutsche Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten geändert hat und wie sich die Veränderungen auf die Schule und auf die Gesellschaft an der Schwelle zum Jahr 2000 auswirken. 1996 hatten 13 % der in Deutschland geborenen Kinder Eltern mit ausländischem Pass, über 7 % stammten aus binationalen Ehen, ca. 2 % waren nicht-eheliche Kinder einer ausländischen Mutter. Werden noch die Kinder hinzugerechnet, deren Eltern als Aussiedler de-jure Deutsche, de-facto aber Zugewanderte sind, und diejenigen, deren Eltern als zugewanderte Ausländer die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen haben oder die doppelte Staatsangehörigkeit besitzen, so haben heute schon rund 30 % oder sogar mehr der in Deutschland geborenen Kinder zwei Eltern oder Großeltern, mindestens aber ein Eltern- oder Großelternteil mit Migrationshintergrund.
Gespaltene Städte
Wenn wir die Lebenssituation von Kindern mit Migrationshintergrund beschreiben, so fällt der Blick stets auf die Gruppe, die besonders benachteiligt ist. Als Beispiel für viele mögliche Bereiche und als Beleg dafür, dass die Kinder mit Migrationshintergrund schlechter gestellt sind, soll die Wohnsituation thematisiert werden. Ausländische Familien leben überwiegend in Ballungsgebieten, konzentriert in bestimmten städtischen Wohnregionen. Die Städte werden räumlich durch Armut und Reichtum gespalten. Diese Trennung der Stadt hat drei Dimensionen: die ökonomische Ungleichheit nach Einkommen, Eigentum und Position auf dem Arbeitsmarkt, die sozialen Unterschiede nach Bildung, gesundheitlicher Lage, sozialer Teilhabe und Position auf dem Wohnungsmarkt und die kulturellen Unterschiede nach ethnischer Zugehörigkeit, Religion, zivilisatorischen Verhaltensformen und normativen Orientierungen. In den schlechter gestellten Stadtteilen, auch als soziale Brennpunkte bezeichnet, sind überdurchschnittlich viele deutsche Haushalte zu finden, die von Sozialhilfeabhängigkeit und Arbeitslosigkeit betroffen sind, sowie Haushalte von Arbeitsmigranten, Flüchtlingen und Aussiedlern. Familien mit Migrationshintergrund wohnen in den innenstadtnahen Altbauquartieren mit einem hohen Anteil von Armutslagen und noch häufiger in Großsiedlungen mit einem überdurchschnittlichen Anteil an Sozialwohnungen. In den Landkreisen leben sie ebenfalls in Gemeinden mit hohem Anteil von Familien in Armutslagen.
Das Aufwachsen von Kindern in sozialen Brennpunkten führt zu besonderen Lebensbedingungen und hat Konsequenzen für die Kinder in allen Lebensbereichen. Armut und Kargheit ist für Kinder aus diesen Wohngebieten räumlich und damit sinnlich im gesamten Nahbereich wahrnehmbar. Es handelt sich um eine erzwungene Segregation, entweder aufgrund einer strukturellen (Mietpreise) oder einer gesetzlich erzwungenen (Einweisung durch die Kommune) Segregation. Das Wohngebiet ist räumlich abgegrenzt. Aus der räumlichen wird die soziale Segregation mit der Handlungsfolge der Stigmatisierung und Diskreditierung aufgrund der Adresse des Wohngebietes, der dort vorherrschenden Bebauung und der Bausubstanz sowie des Wohnumfeldes und der dort lebenden Bewohner. Das Wohnumfeld wird durch seine Bewohner geprägt und prägt seine Bewohner, insbesondere aber die Kinder und das Kinderleben: reduzierte Einkaufsmöglichkeiten, minimale Gemeinschafts- und Freizeiteinrichtungen, das Fehlen einer attraktiven Infrastruktur, und – so folgt in den Schilderungen – der hohe Anteil von Problemfamilien, Langzeitarbeitslosen und Sozialhilfeempfängern sowie ein teils sehr hoher Anteil von Ausländern und Aussiedlern.
Selten Thema
Das Wohnumfeld ist aber auch zukunftsprägend, bei schlechten Bedingungen zukunftsgefährdend: die schlechte infrastrukturelle Versorgung, die häufig geringere Qualität der Grundschulen wirkt sich negativ auf die Bildungs- und damit auf die Berufschancen aus.
Kaum thematisiert wird, was das Aufwachsen in solchen Regionen für die Kinder aus Zuwandererfamilien und für die Eltern bedeutet – und zwar über die Einschränkung hinaus, die auch für deutsche Kinder gelten. Eltern aus Zuwandererfamilien errichten ein zweites Getto im sozialen Brennpunkt für ihre Kinder: Sie suchen Kontakte zu deutschen Kindern aus dem Wohnumfeld soweit wie möglich zu verhindern, da sie deren Verhalten nicht akzeptieren und die Lebensformen der deutschen Familien ablehnen. Für die Eltern und noch mehr für die Kinder, die kaum über Differenzierung erlaubende Erfahrungen verfügen und die wenig Zugänge zu deutschen Lebensformen besitzen, wird die Vorstellung vom deutschen Familienleben durch das geprägt, was sie im sozialen Brennpunkt erfahren. Das dort wahrgenommene Familienleben wird ebenso abgelehnt wie das, was sie über das Verhalten und die Erziehung der Kinder wahrnehmen oder wahrzunehmen glauben.
Konsequenzen
Es ist erforderlich, die materielle Situation und das Wohnfeld und darüber hinaus die Bildungssituation von Familien mit Kindern in sozialen Brennpunkten allgemein zu verbessern, davon würden auch Familien mit Migrationshintergrund profitieren.
Es ist aber auch notwendig, den Zugewanderten, noch in der dritten Generation als Ausländer hier lebenden politische Rechte (doppelte Staatsangehörigkeit) anzubieten, damit sie im Stadtteil, in der Kommune und im Staat Mitspracherechte erwerben.
In den Wohngebieten, in denen Zugewanderte in größerer Zahl leben, kommt es stets zu einer Kumulation von umweltbedingten und sozialen Problemen. Es ist zu vermuten, dass die ethnischen Gettos mit ihrer eigenen kulturellen Ausprägung eher günstigere Voraussetzungen für Kinder aus Zuwandererfamilien bieten als das Leben im sozialen Brennpunkt, in dem zusätzlich die früher latenten Konflikte zwischen Deutschen und Zugewanderten in offener Form der Ablehnung eingemündet sind. Das Getto hingegen verfügt über eine gewachsene Infrastruktur, hat soziale Netze ausgebaut und kann Ressourcen mobilisieren. Dennoch: Die Nachteile des Aufwachsens von Kindern in sozial vernachlässigten Regionen, sei es im sozialen Brennpunkt, sei es im ethnischen Getto, können nicht hoch genug eingeschätzt werden. Der Landessozialbericht über Ausländer und Ausländerinnen in Nordrhein-Westfalen geht sogar davon aus, dass die unzureichende Wohnsituation in den erneuerungsbedürftigen Stadtteilen psychisch und physisch krank macht, zu Störungen der familiären Beziehungen führt, die Wirksamkeit schulischer Fördermaßnahmen für die Kinder gefährdet, das wechselseitige Kennenlernen von Deutschen und Ausländern verhindert und zur Isolation vor allem der nicht-berufstätigen ausländischen Frauen beitragen kann.
Die kommunale Planung ist gefordert, die Lebensbedingungen von Kindern in einer Region und damit auch der Kinder aus Zuwandererfamilien zu verbessern. Ziel des Erneuerungsprozesses muss die Herstellung von Gleichwertigkeit, die Verbesserung der Lebensbedingungen und die Verhinderung des Herausfallens ganzer Stadtteile aus dem allgemeinen Entwicklungsprozess sein. In einem aktiven Erneuerungsprozess sind allen Bewohner und Bewohnerinnen Lebenschancen, Handlungs- und Entscheidungsspielräume zu eröffnen, ohne dass im Ergebnis der Auswertung große Teile von ihnen in andere Armutsquartiere verdrängt werden.
Die Vermeidung weiter sozialer Entmischung und die Reduktion des Zuwandereranteils stellt ein reglementierendes Ziel dar, das keine Priorität haben sollte. Weder restriktive Beschränkungen noch die Unterstützung von Randgruppen (z.B. Aussiedler, Ausländer, kinderreiche Familien) können das eigentliche Ziel einer Stadtstrukturplanung darstellen, sondern die Stärkung benachteiligter sozialer Räume. Die infrastrukturelle Vernachlässigung gerade dieser Gebiete zu beseitigen ist die vordringliche (kommunale) Aufgabe. Diese "aufgewerteten" Stadtviertel würden dann auch für andere Bevölkerungsteile attraktiv werden.
Prof. Dr. Ursula Boos-Nünning ist Professorin für interkulturelle Pädagogik an der Universität Essen und Mitglied in der Sachverständigenkommission 10. Kinder- und Jugendbericht