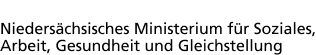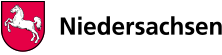- Editorial 2/1999
- Hiltrud Stöcker-Zafari: Politik mit dem Neid
- Swaantje Düsenberg: Alle Kinder sind gleich
- Leonie Herwartz-Emden: "Sie sollen es besser haben"
- Ursula Boos-Nünning: "Zukunft im Blick"
- Manfred Bönsch: Da ist immer noch ein Problem
- Harry Hubert: Lebenswelt im Zentrum
- Kolumne - Verletzte Seelen
- Arzu Altug: "Ich mag Herausforderungen"
- Monika Ruprecht: Konkreter Impuls - Ein Projekt für jede Frau und jeden Mann
- Impressum Ausgabe 2/1999
Leonie Herwartz-Emden: "Sie sollen es besser haben"
Die Familie, wie auch immer sie sich zusammensetzt, ist in den ersten Lebensjahren eines Kindes der wichtigste Sozialisationsort und bleibt dies auch viele Jahre. Von der immer wieder geforderten Geborgenheit des familiären Schoßes aus macht ein Kind nicht nur seine ersten Schritte ins Leben, sondern es lernt auch etwas über seine zukünftige Rolle als Mann oder Frau, Mutter oder Vater u.v.m.
Für alles scheint die Familie zuständig zu sein: für den Schutz und die Liebe, für die Zukunftschancen der Kinder und ihre Rechtschaffenheit. Nun ist bekannt, dass dieser Verantwortung viele deutsche Familien kaum noch nachkommen können. Migrantenmütter und -väter sind aber noch ganz anderen Belastungen ausgesetzt als ihre deutschen Pendants. Am Willen und Wollen, dass das Aufwachsen ihrer Kinder gelingen möge, liegt es nicht, denn dieser Wunsch ist maßgebliche Motivation für Einwanderungen oder auch Flucht. Was also belastet Familien in der Migration besonders, wie werden sie damit fertig und was brauchen sie, um ihre Kinder trotzdem ins Leben begleiten zu können?
Das Alltagsbewusstsein über Einwandererfamilien ist nach wie vor vom Bild der "typischen (kinderreichen) Familie" geprägt – eine Vorstellung, die empirisch nicht haltbar ist. In vielen, die Familie unmittelbar betreffenden Merkmalen nähert sich die ausländische Bevölkerung der deutschen Bevölkerung an, nicht nur mit der sinkenden Kinderzahl, dem steigenden Heiratsalter, durch verbesserte Wohnverhältnisse und steigendes Bildungsniveau (wenn dies auch noch weit entfernt ist vom Bildungs- und Ausbildungsniveau der deutschen ansässigen Kinder und Jugendlichen). Die Familiengröße der ausländischen Bevölkerung ist nach Nationen sehr verschieden, "schrumpft" aber kontinuierlich. Türkische Familien haben durchschnittlich 2,2 Kinder, spanische und jugoslawische Familien 1,8. Über die in den Herkunftsländern lebenden Kinder von Migrantenfamilien ist wenig bekannt, jedoch leben selten Kinder unter 9 Jahren in der Heimat der Eltern.
Lebensformen
Die zentralen demographischen Merkmale der privaten Haushalte in Deutschland haben sich stark gewandelt und die Formen heutigen Familienlebens sind äußerst vielfältig und unterschiedlich. Von dieser Entwicklung sind auch die in Deutschland lebenden Einwanderer betroffen. Haushalte werden immer kleiner, die Zahl der kinderlosen Ehepaare nimmt zu und in über der Hälfte aller Ehen wird heute entweder kein oder nur ein Kind geboren; nicht eheliche Lebensgemeinschaften (statistisch schwer erfassbar) nehmen zu und die Zahl der Alleinerziehenden, meistens als Familien alleinerziehender Mütter, wächst. Und es gibt immer mehr Stieffamilien.
Das Leben in einer traditionell strukturierten Familie als Vater-Mutter-Kind-Einheit ist zwar nach wie vor sehr verbreitet, stellt aber längst nicht mehr die einzige familiale Lebensform dar. Allerdings ist die Frage, ob sich mit den veränderten Strukturen auch die subjektive Bedeutung von Partnerschaft, Ehe und Familie verändert hat, schwer zu beantworten. Denn subjektive Bedeutungen sind nicht einfach zugänglich und messbar wie etwa demographisch-statistische Veränderungen. Der Wandel sozialer Tatbestände führt aber nicht zwangsläufig auch zu einer veränderten subjektiven Bedeutsamkeit spezifischer Lebensentwürfe.
Familie bleibt wichtig
Im Zuge der Individualisierung und Modernisierung der Gesellschaft und der damit einhergehenden Veränderung der Lebensformen scheint sich in Deutschland keine grundsätzlich andere Bewertung des Lebensmodells Familie ergeben zu haben. Vielmehr stellt die Orientierung an einem Leben mit Kindern und Partnerin und Partner bzw. Ehepartnerin und Ehepartner nach wie vor einen hohen Wert dar. Der häufig propagierte "Zerfall" der Familie, der, so die Annahme, durch moderne Lebensbedingungen hervorgerufen werde, kann nicht bestätigt werden. Bestätigt werden kann vielmehr eine nach wie vor vorhandene Bindungsbereitschaft der Einzelnen – wenn auch, wie oben dargelegt wurde – in vielfältigen Formen und Lebensmodellen. Auch für eingewanderte Familien in Deutschland bleiben die Familie und das Zusammenleben in Familien eine ungebrochene Zielgröße in der Werteskala und im Lebenslauf.
Unter der Bedingung von Migration und Einwanderung ist Familie zunächst einmal der Ausgangspunkt für die Auswanderung, sodann für die Arbeitsaufnahme im Einreiseland bzw. für die Einwanderungsmotivation im allgemeinen. Das Überleben der Kinder zu sichern und die Zukunft der Kinder zu garantieren, ist die Hauptmotivation für die meisten Wanderungsprozesse.
Umbrüche
Einwandererfamilien treffen in Deutschland auf eine westliche Marktwirtschaft und eine Konsum- und Leistungsgesellschaft, deren Strukturen ihnen nicht selten weitgehend unbekannt sind. Ihr Niederlassungsprozess ist durch Umbrüche gekennzeichnet, die sich in vielfältigen Bereichen ausmachen lassen. Zusätzlich treffen sie auf ein fremdenfeindliches Klima und geraten in eine Lebenssituation, die von zahlreichen Ausgrenzungen und Diskriminierungen gekennzeichnet ist.
In der Migration ist die Familie der Ort für das alltägliche Überleben und die Organisation des Alltags. Darüber hinaus bietet die Familie Schutz und Raum für die ethnische Identifikation und die Identitätssicherung in einer häufig feindlichen Umgebung. Die Familie ist der Ort, an dem sich die zentralen Prozesse der Sozialisation und Erziehung der Kinder abspielen, an dem sie täglich betreut werden.
Die Rahmenbedingungen des Alltags mit Kindern und der Kindererziehung in Deutschland sind dabei für die ausländischen Familien ebenso maßgebend wie für die deutschen Familien mit Kindern.
Veränderte Kindheit
Die gesellschaftlichen Bedingungen von Kindheit haben sich verändert. Es gibt eine kontinuierliche erhebliche Zunahme der außerhäuslichen Erwerbstätigkeit von verheirateten Frauen und von Müttern. Zwischen 1950 und 1980 hat sich die Erwerbstätigkeit der einheimischen deutschen Mütter fast verdoppelt. Die Gruppe der Einwanderinnen mit Kindern weist in der Regel eine noch höhere Quote der Erwerbstätigkeit auf als deutsche Mütter. Mehr als ein Drittel der ausländischen Frauen arbeiten aushäusig, wobei die tatsächliche Quote noch höher liegen dürfte, da viele ausländische Frauen nicht sozialversicherungspflichtig, also in ungeschützten Arbeitsverhältnissen tätig sind. Nach Schätzungen arbeiten bis zu 2,4 Millionen Frauen in Westdeutschland in Privathaushalten in nicht erfassten Arbeitsverhältnissen und man muss davon ausgehen, dass der Ausländerinnenanteil daran sehr hoch ist. Von den sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen gingen bereits 1992 über 80% einer Vollzeitbeschäftigung nach. Die Frau ist also wie der Mann in der Familie große Teile des Tages außer Haus tätig und die verbleibende Hausarbeit und Kinderbetreuung muss in irgendeiner Weise "nebenbei" geleistet werden.
Mütter als Dreh- und Angelpunkt
Auch wenn beide Elternteile erwerbstätig sind, sind es dennoch die Mütter, die weitgehend für die Erziehungsarbeit im Alltag zuständig sind – wobei sich bei den zugewanderten Familien oft eine höhere Bereitschaft zeigt, die alltägliche Erziehungsarbeit zwischen Mutter und Vater aufzuteilen, als in einheimischen Partnerschaften. Trotzdem kümmern sich insbesondere die Mütter darum, ihre Kinder in den Kindergarten oder in die Schule zu transportieren und sie in der Freizeit mit anderen Kindern zusammen zu bringen. Es ist in Deutschland zunehmend gefährlich, Kinder draußen unbeaufsichtigt spielen zu lassen. Das bedeutet für viele ausländische Familien eine große Veränderung. Außerdem gehört es für viele Eltern zur alltäglichen Erziehungsarbeit, ihre Kinder an organisierten Freizeitaktivitäten teilhaben zu lassen.
Auch hinsichtlich der Art der Kinderbetreuung hat sich etwas verändert: weg von der reinen Versorgung hin zu einer Intensivierung der Beziehung und der Auseinandersetzung mit dem Kind. Die Pädagogisierung und Psychologisierung der Kindheit, die in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg breite Bevölkerungsschichten in Deutschland erfasste und durch die Bildung der Frauen einen zusätzlichen Schub erfuhr, hat dazu geführt, dass der alltägliche Betreuungsaufwand für Kinder nicht weniger geworden ist, sondern sich qualitativ verändert hat. Die stärkere Betonung und Unterstützung der individuellen Bedürfnisse der Kinder übersetzt sich in der alltäglichen Lebensführung charakteristischerweise in Alltagsarbeit für die Eltern – und hier wieder in Arbeit für die Mütter. Diese qualitative Intensivierung des alltäglichen Arbeitsaufwands für Kinder setzt sich bei der institutionalisierten Kinderbetreuung fort (z.B. selbstverwaltete Kinderläden/gärten; Elternmitarbeit in der Schule). Dennoch ist eines bei allen Veränderungen gleich geblieben: die Zeitrhythmen von Kindergarten und Schule sind nach wie vor am Leitbild der traditionellen Familienform orientiert, das traditionelle Arbeitszeitmuster bzw. Arbeitszeiten einschließt (z.B. Vater arbeitet Vollzeit, Mutter ist ständig zu Hause erreichbar). Auf der Seite der Institutionen wird also immer noch davon ausgegangen, dass selbstverständlich jemand zu Hause verfügbar ist. Diese Bedingung ist für ausländische Familien schwer zu erfüllen.
Der Umbruch, der im Erziehungsbereich von vielen Arbeitsmigrantenfamilien bereits bewältigt wurde, hat gegenwärtig viele Aussiedlerfamilien erfasst. In ihren Herkunftsländern – vor allem in der ehemaligen Sowjetunion – war die staatliche Betreuung die Regel, zusätzlich stand die ältere Generation für die Kinderbetreuung zur Verfügung. In Deutschland sind die Familien mit der Anforderung konfrontiert, ihre Kinder täglich individuell und persönlich betreuen und als Eltern in hohem Maße zur Verfügung stehen zu müssen. Zugleich nehmen ausländische Familien die Kindergartenbetreuung sehr viel seltener in Anspruch als deutsche Familien. Nur 57,7% der Drei- bis Achtjährigen mit ausländischem Pass besuchen einen Kindergarten, aber 74,2 % der deutschen Kinder, obwohl der Kindergarten an sich sowohl von Aussiedler- wie Migrantenfamilien positiv bewertet wird.
Die Bildungsorientierung von Migrantenfamilien ist generell sehr hoch, denn die Sicherung der Zukunft der Kinder ist eine herausragende Migrationsmotivation. Der Erfolg der Kinder in der Aufnahmegesellschaft wird als sichtbares Zeichen des Erfolges der Migration gewertet und belohnt für die Mühen und zahlreichen Entbehrungen. Mit der Frage, warum die Bildungschancen für ausländische Kinder im deutschen Schulsystem nach wie vor schlecht sind, beschäftigt sich Manfred Bönsch in diesem Heft.
Trennungskonflikte
Einwandererfamilien und jedes einzelne Familienmitglied müssen zahlreiche Konflikte bewältigen. So geht Migration immer mit Trennungen einher, die emotional oft sehr belastend sind. Sie stören nicht nur die Beziehungen, sondern auch die Schulkarrieren der Kinder sowie generell ihre Möglichkeit, sich im hiesigen Kontext wohl zu fühlen und integriert zu werden. Oft mussten die Kinder ihre Freunde, ihre Schule sowie ihr gesamtes Umfeld verlassen und diese Trennung verarbeiten. Das Thema Trennungen ist nicht mit dem Zeitpunkt beendet, von dem an die Kernfamilie in Deutschland zusammenlebt. Der Migrationsprozess ist damit nur scheinbar abgeschlossen, Familienzusammenführung und auch Trennungen sind für alle Familienmitglieder jeder Generation aber dauerhaft zu bewältigen. Binnenmigration, Pendeln, Remigration und möglicherweise erneute Einwanderung bedeuten immer wieder, in der Familie eine neue Struktur zu gestalten. Hier kommt der Frau und Mutter eine besondere Rolle zu. Sie ist auf Grund ihrer geschlechtsspezifischen Verantwortung im Bereich der Fürsorge- und Pflegeaufgaben von Familien in besonderer Weise mit emotionalen Belastungen konfrontiert. Von ihrer Kompetenz und der Fähigkeit der Verarbeitung widersprüchlicher Anforderungen sowie deren Vermittlung an die einzelnen Familienmitglieder hängt in hohem Maße die psychosoziale familiäre Situation ab und in hohem Maße die Bewältigung des Integrationsprozesses der Familie.
Eine weitere Belastung der Migrantenfamilien besteht darin, dass die einzelnen Familienmitglieder oder auch die Generationen unterschiedlich in die Aufnahmegesellschaft integriert sind. Wenn z.B. ein Ehepartner – oft ist es die Frau – keine Arbeit findet, reduziert sich ihre Integrationschance in die deutsche Gesellschaft, weil sie dann sowohl sozial als auch emotional hinter den Erfahrungen des anderen zurückbleibt. Für Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz finden, ergeben sich ebenfalls ähnlich schwierige und oft krisenhafte Situationen.
Geschlechterrollen
Eine herausragende Anforderung für die Migrantenfamilien liegt in der Veränderung der Geschlechterverhältnisse. Sie sind in Deutschland mit anderen Frauen- und Männerbildern, einer anderen Definition der Geschlechteraufgaben, der Arbeitsteilung und generell mit anderen Definitionen der Bewegungsräume der Geschlechter konfrontiert. Das führt für Zuwanderer zu einer täglich zu bewältigenden Irritation. Die Interpretation dieses Konfliktes kann allerdings nicht auf der Grundlage des einfachen Modells "Tradition versus Emanzipation" vorgenommen werden. Vielmehr belegen schon frühe Studien in den 80er Jahren, dass Migrantinnen zwar ihre gesamten Einstellungskonzepte und ihr Verhalten verändern – aber dies sehr unterschiedlich. Heute ist das Frauenbild und das Selbstkonzept von Einwanderinnen aus weniger industrialisierten Gesellschaften nicht selten durch geringere Abhängigkeiten vom Mann gekennzeichnet als das westlicher Frauen. Ebenso lässt sich für männliche Migranten nachweisen, dass sie nicht schlicht autoritärer oder patriarchalischer gesinnt sind als westliche Männer. Im Gegenteil ist ihre Bereitschaft, sich in hohem Maße zum Beispiel ihren väterlichen Aufgaben zu widmen, sich auf die veränderten Bedingungen einzustellen und ihre Konzepte in Frage zu stellen, groß. So finden sich beispielsweise in türkischen Familien und in Aussiedlerfamilien aus der ehemaligen Sowjetunion tendenziell partnerschaftliche ‘Vereinbarkeitsleistungen’ in der Betreuung und Versorgung der Kinder sowie generell in der Definition und Ausgestaltung der elterlichen Aufgaben.
Fazit
Migrantinnen und Migranten erbringen herausragende Integrationsleistungen. Innerhalb kürzester Zeit passen sich z.B. die Frauen den hiesigen Bedingungen an, wie alleine die Geburtenrate, das Heiratsalter, aber auch die Gestaltung der ehelichen Verhältnisse zeigen. Für ihre Freiräume ergeben sich dadurch sowohl Gewinne als auch Verluste im Einwanderungsprozess. Die vereinfachende Vorstellung über den ’Emanzipationsgewinn’ durch Erwerbstätigkeit der Frau greift jedoch nicht. Vielmehr ist die Gesamtsituation eine Herausforderung für alle Beteiligten und bedarf gemeinsamer Lösungen. Denn die Migration ist in der Regel ein gemeinsames Projekt von Mann und Frau, dem die Gestaltung der ehelichen bzw. partnerschaftlichen Verhältnisse untergeordnet bzw. angepasst wird.
Prof. Dr. Leonie Herwartz-Emden, Sozialwissenschaftliche Fakultät, Fachgruppe Erziehungswissenschaft an der Universität Konstanz