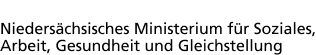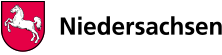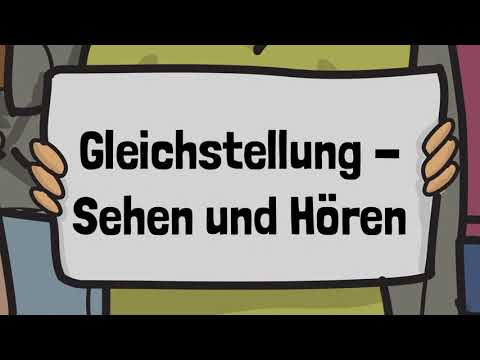Der Juliane Bartel Medienpreis 2025
Gleichstellung Sehen oder Hören – linear und online
Die Juliane wurde vergeben!
Zum 24. Mal wurde am 18. November 2025 in Hannover der Juliane Bartel Medienpreis verliehen. Vor rund 300 Gästen würdigte eine mit Fachleuten aus dem Bereich Medien besetzte Jury herausragende Beiträge, die die Diskriminierung von Frauen entlarven und auf amüsante, aber auch ernste und berührende Art den Kampf um Gleichberechtigung thematisieren.
Insgesamt gab es in diesem Jahr 175 Einreichungen in den Kategorien Shorts, Doku visuell, Doku audio und Fiktion & Entertainment. Davon schafften es 21 Beiträge in den Kreis der Nominierten.
Bilder und Impressionen der Veranstaltung können unter folgendem Link heruntergeladen werden:
Ausgezeichnet wurden:
>>Kategorie Shorts<<
Muttertag: Für Frauen in Kolumbien einer der gefährlichsten Tage
Magazinbeitrag (audio), 4’30, Deutschlandfunk Nova
Autor: Bastian Kaiser
Wenn in Kolumbien Muttertag ist, werden Frauen gebührend gefeiert, doch zugleich werden sie ausgerechnet an diesem Tag in zahlreichen Fällen ermordet oder angegriffen. Der Beitrag berichtet in prägnanter Weise über die Ambivalenz dieses Feiertags, der in Kolumbien beinahe so wichtig ist wie Weihnachten. Weil nicht gearbeitet wird, sind die Familien gemeinsam zu Hause – ein Umstand, der von gewalttätigen Ehemännern häufig ausgenutzt wird, um ihre Frauen zu bedrohen. Um dem Problem zu begegnen, hat Bogota bereits einen Sicherheitsplan eigens für diesen Tag entwickelt. Und auch Initiativen von Frauen, die selbst Gewalt durch ihre Ehemänner erfahren haben, existieren inzwischen. Juliana Panesso ist eine von ihnen – ihr Ziel ist es, mit ihrer Organisation anderen Frauen Mut zu machen und ihnen Schutz zu bieten.
(Zum Beitrag)
>>Kategorie Doku audio<<
Die Entfremdungslüge – wie rechte Netzwerke das Familienrecht unterwandern
Feature, 54’18, Deutschlandfunk / SWR Kultur
Autor und Autorin: Heiko Rahms und Stephanie Schmidt
Mit einer intensiven und beeindruckenden Rechercheleistung arbeitet dieses Feature einen gravierenden Missstand im deutschen Familienrecht heraus, welcher Männer systematisch stärkt und Frauen ebenso systematisch schwächt. In zahlreichen Fällen wurden bei Frauen psychische Krankheiten diagnostiziert, um ihnen ihre Kinder wegnehmen zu können und das alleinige Sorgerecht den Vätern zu übertragen – stets mit dem Vorwurf, die Frau würde die Kinder dahingehend manipulieren, dass sie keine Beziehung mit dem Vater haben wollen. Die Entscheidungen der Gerichte folgen stets einem Gutachten und hier lassen sich, so zeigt die Recherche, immer wieder die gleichen Argumente finden. Sie basieren auffallend häufig auf einer Argumentationsweise, wie sie in der Theorie des wissenschaftlich längst überholten „ParentalAlienation Syndrome“ (PAS) formuliert wurden. Es ist eine Theorie, dessen Autor sich offen für Pädophilie ausspricht und die in der Anwendung eine große Gefahr für Frauen und Kinder darstellt. Gewalttätige Väter können so geschützt werden und zum Beispiel sexuelle Übergriffe weiter ausüben. Das Feature deckt ebenfalls auf, dass sich in Deutschland ein Netzwerk mit rechtsnationalen Tendenzen aus Richtern und Gutachtern bzw. sogar Gutachterinnen gebildet hat, das aktiv diese Theorie anwendet und Gerichte darin weiter schult.
(Zum Beitrag)
>>Kategorie Doku visuell<<
Reportage, 54’14, NDR
Autorinnen: Isabell Beer, Isabel Ströh und Mette Marit Olsson
Die Reportage zeigt, was Investigativjournalismus leisten kann und weshalb er unentbehrlich ist. In ihrer Recherche zu OnlineNetzwerken von Vergewaltigern haben die Journalistinnen dazu beigetragen, dass Vergewaltigungsopfer geschützt und Straftäter verfolgt werden. Frappierend macht diese Reportage deutlich, dass auf öffentlich zugänglichen Pornografieplattformen tausende Videos von bewusstlosen Frauen kursieren, die in allen Formen vergewaltigt werden. In vielen Fällen sind es direkte Familienangehörige der Täter, die von den Taten über Jahre nichts mitbekommen, weil sie zuvor betäubt werden. Zwei der betroffenen Frauen kommen in dem Beitrag auch zu Wort – die Videos von ihnen kursieren noch immer im Internet, einfach weil sie tausendfach heruntergeladen und neu hochgeladen wurden. Was die Recherchen ebenfalls zeigen, ist die Behäbigkeit der Behörden. Eine Frau wurde noch ein Jahr lang mehrmals im Monat weiter vergewaltigt, weil nicht mit aller Ernsthaftigkeit reagiert wurde.
(Zum Beitrag)
>>Kategorie Fiktion und Entertainment<<
Fernsehfilm, 90’00, ARD
Autor: Uli Brée
In diesem Film steht Transfrau Josefa im Mittelpunkt. Sie wohnt in München und erhält eines Tages ein Schreiben vom Notar, das sie darüber informiert, alles von ihrer Mutter nach deren Tod vererbt bekommen zu haben. Seit 35 Jahren hatte Josefa mit ihr, dem Rest der Familie und ihrem besten Freund aus der damaligen Zeit keinen Kontakt mehr. Auch wenn der Freund immer zu ihr stand, war sie grundsätzlich in ihrem kleinen bayerischen Heimatdorf, das von tiefen patriarchalen Strukturen geprägt ist, spätestens nach ihrem Outing nicht mehr erwünscht. Sie erfand sich in der großen Stadt vollkommen neu. Durch das Schreiben vom Notar wendet sie sich dem Dorf, ihren alten Beziehungen und allgemein dieser frühen Phase ihres Lebens wieder zu und arbeitet so alte Verletzungen auf.
(Zum Beitrag)
Außerdem hat die Jury einen geteilten Sonderpreis vergeben an:
>>Kategorie Shorts<<
Ottilie Roederstein als Toast
InstagramReel, 1’00, ZDF
Autorinnen: Ludmila Graf und Jette Lübbehüsen
Kunst mal anders! Statt Ölfarben und Leinwand kommen hier Brotaufstriche und Toastbrot zum Einsatz, um Kunstwerke zu schaffen. Sie sind nicht nur schön, sondern auch essbar. Das Problem: Die berühmtesten Bilder der Moderne waren stets Werke von Männern. Doch dieses Reel widmet sich stattdessen gezielt einer Frau! Es geht um das Gemälde „Selbstportrait mit Hut“ von Ottilie Roederstein aus dem Jahr 1909. Sie ist, wie viele weibliche Künstlerinnen, durch die Geschichtsschreibung weitgehend in Vergessenheit geraten, und das, obwohl sie zu ihrer Zeit bekannt und erfolgreich war. In aller Kürze schafft es dieses Reel darüber zu informieren und auch weitere Fakten einzustreuen, etwa, dass Frauen erst seit 1919 Kunst an Universitäten studieren durften und dass sich deshalb Roederstein nicht nur eigenständig eine Ausbildung in der Malerei suchte, sondern auch aktiv dafür einsetzte, dass Frauen Kunst studieren können.
>>Kategorie Doku visuell<<
Sieben Winter in Teheran
Dokumentation, 88’00, ARD
Autorin: Steffi Niederzoll
Intensiv und in allen ihren bedrückenden Facetten erzählt dieser Dokumentarfilm die Geschichte von der Iranerin Reyhaneh Jabbari, die, während sie drohte vergewaltigt zu werden, ihren Peiniger umgebracht hat. Obwohl sie aus Notwehr handelte, wird sie verhaftet. Schnell wird vermutet, dass der Mann, der sie belästigte, Verbindungen zum Geheimdienst hat – es werden angebliche Beweise für ihr Fehlverhalten entdeckt und sie wird letztendlich zur Todesstrafe verurteilt. Sieben Jahre lang harrt sie noch in den Gefängnissen in und um Teheran aus. Ihre Familie versucht bei der Familie des Mannes, den sie erstochen hat, um Gnade zu bitten, was nicht gelingt. Während ihrer Zeit im Gefängnis dokumentiert sie ihre Erlebnisse und lässt sie hinausschmuggeln. Der Film basiert auf diesen Schilderungen und erzeugt dadurch eine beeindruckende Nähe zu der Protagonistin. Der Fall wird, auch während sie noch einsitzt, weltweit publik. Menschen gehen auf die Straßen und Zeitungen sowie Fernsehsendungen berichten.
Der Preis: Worum geht's?
Mit dem renommierten Juliane Bartel Medienpreis würdigt das Land Niedersachsen Autorinnen und Autoren, die in ihren Fernseh-, Hörfunk- und Internet-Beiträgen auf ernste oder unterhaltsame Weise die Gleichstellung von Frauen und Männern thematisieren und dabei Rollenkonflikte sichtbar machen. Die prämierten Beiträge rütteln wach und machen gleichzeitig Mut, denn sie zeigen nicht nur Missstände, sondern auch positive Beispiele, die für uns alle ein Ansporn darstellen sollten, das Thema stets im Blick zu behalten.
Das Preisgeld: Wohl verdient
Der Juliane Bartel Medienpreis ist mit insgesamt 12.000 Euro dotiert. Das Preisgeld verteilt sich auf die vier Kategorien zu jeweils 3.000 Euro. Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten zudem die Skulptur der Künstlerin Ulrike Enders.
Ferner behält sich die Jury vor, zusätzlich einen Sonderpreis zu vergeben, der mit maximal 3.000 Euro dotiert ist.
Juliane Bartel: Wer ist das?
Juliane Bartel (1945-1998) war eine couragierte und engagierte Journalistin sowie Hörfunk- und Fernsehmoderatorin, die in "S-F-Beat", einer Jugend-, Musik- und Infosendung, und später dann auch in der Tagesmagazinsendung „Echo am Morgen“ zu hören war. Ihren Durchbruch beim Fernsehen hatte Juliane Bartel mit der Talkshow „3 nach 9“, durch die sie von 1989 bis 1998 führte. Zuvor moderierte sie im ZDF die Sendung Spielraum und ab 1993 "Alex" beim Sender Freies Berlin. Zu dieser Zeit gab es nur wenige Frauen in dieser Rolle zu finden.
Die Kooperationspartner: Zusammen stark
Der Juliane Bartel Medienpreis hat starke Partner an seiner Seite.
In Kooperation mit
· dem Norddeutschen Rundfunk,
· der Niedersächsischen Landesmedienanstalt,
· der Hochschule Hannover,
· der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover,
· der nordmedia – Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH,
· dem Film & Medienbüro Niedersachsen e.V.,
· der „Initiative Klischeefrei“ über das Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V.,
· dem Landesfrauenrat Niedersachsen e.V.,
· dem Rundfunk Berlin-Brandenburg,
· dem Bundesverband Regie e.V.
· der Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros Niedersachsen und
· der Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
· dem NiKa e.V. - Niedersächsisches Karrierenetzwerk für Frauen im öffentlichen Dienst
· dem ZDF
richtet das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung den Juliane Bartel Medienpreis aus.
Die Jury: Expertinnen und Experten unter sich
Die eingereichten Beiträge werden von einer Vorjury gesichtet und nominiert. Dabei bringen unsere Kooperationspartnerinnen und -partner ihre Expertise ein.
Kurz vor der Preisverleihung sichtet und bewertet dann eine Fachjury aus den Bereichen Journalismus, Schauspiel, Redaktionen, Produktionen und einer Vertretung der Hochschule Hannover die nominierten Beiträge und entscheidet abschließend, welcher Beitrag in den Kategorien gewonnen hat.
Die Preisverleihung: Das Gute zum Schluss
Das NDR-Landesfunkhaus in Hannover bietet die optimale Bühne für die Medienpreisverleihung. Die Preisträgerinnen und Preisträger des Wettbewerbs werden im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung mit Gästen aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft geehrt.
 Bildrechte: ms
Bildrechte: ms
Wir sind nicht süß! – Der Juliane Bartel Medienpreis.
Ihre Ansprechperson:
Birgit Meseberg
Telefon 0511 - 120 2964
Lena Ochs
Telefon 0511 - 120 2962