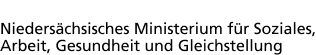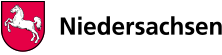Wasserhygiene
Trinkwasser
In Niedersachsen ist das Trinkwasser flächendeckend von sehr guter Qualität. Dies wird durch umfassende Qualitätskontrollen der Wasserversorgungsunternehmen sichergestellt.
Auch Haus- und Wohnungseigentümer, Inhaber von Hausbrunnen und diejenigen, die Wasser aus einer mobilen Wasserversorgung (z. B. in Flugzeugen, Schiffen, Jahrmarktständen) zur Verfügung stellen, tragen Verantwortung dafür, dass die europaweit geltenden Mindestanforderungen an die Trinkwasserbeschaffenheit eingehalten werden. Dies soll die Reinheit und Genusstauglichkeit eines gesunden Trinkwassers garantieren.
Die örtlichen Gesundheitsbehörden (Landkreise und kreisfreie Städte) haben den gesetzlichen Auftrag, die Trinkwasserqualität zu überwachen, die Bevölkerung zu beraten und ggf. über gesundheitliche Gefahren aufzuklären.
Die Beurteilung der Wassergüte erfolgt insbesondere durch Laboruntersuchungen.
Im Rahmen der Laboruntersuchungen wird das Trinkwasser auf mikrobiologische-, chemische-, radioaktive Parameter, sowie allgemeine Indikatorparameter untersucht.
So kann beispielsweise festgestellt werden, ob sich Blei, E. coli Bakterien, Coliforme Bakterien, Legionellen, Nitrat, Benzol, Pestizide, Quecksilber, Nitrit, Chlorid, Eisen, Uran im Trinkwasser befindet.
Daneben wird auch beispielsweise die elektrische Leitfähigkeit, die Färbung, der Geruch, der Geschmack, sowie die Wasserstoffionenkonzentration (pH-Wert) des Trinkwassers überprüft.
Die Untersuchungen einschließlich der Probenahme dürfen nur von dafür zugelassenen Trinkwasser-Untersuchungsstellen durchgeführt werden.
Informationen für die Verbraucher des Trinkwassers
Der Mensch besteht je nach Alter zu 50 bis 70 Prozent aus Wasser. Er scheidet es immer wieder aktiv aus und braucht daher regelmäßig Nachschub. Sauberes Wasser braucht man nicht nur zum Trinken, sondern auch zum Zubereiten von Speisen und Getränken, zur Körperpflege, zum Abwaschen oder zum Wäsche waschen.
Die tägliche Trinkwassernutzung im Haushalt und Kleingewerbe ging von 144 Liter je Einwohner und Tag im Jahr 1991 lange Jahre zurück bis auf täglich 123 Liter pro Kopf im Jahr 2016 und steigt seitdem wieder leicht: 2019 wurden von jedem im Schnitt 128 Liter verbraucht – insgesamt also knapp 130 Liter (Quelle: Umweltbundesamt). Das entspricht einer Jahresmenge von etwa 47,5 m3 für einen Einpersonenhaushalt, bzw. circa 95 m3 für einen Zweipersonenhaushalt.
Trinkwasser ist ein Naturprodukt und wird zu 70 Prozent aus Grund- und Quellwasser gewonnen. Zu 13 Prozent wird See-, Talsperren- oder Flusswasser direkt genutzt. Die übrigen 17 Prozent bestehen aus Oberflächenwasser, das teilweise eine Uferfiltration oder Bodenpassage durchlaufen hat.
Trinkwasser schmeckt in jeder Gegend etwas anders, je nach den Mineralien, die sich aus dem jeweiligen Untergrund im Wasser lösen. Trinkwasser soll zum Genuss anregen, also farblos, klar, kühl sowie geruchlich und geschmacklich einwandfrei sein. Die Qualität des Trinkwassers wird in der Trinkwasserverordnung gesetzlich geregelt; hinzu kommen verschiedene Leitlinien, Rechtliche Grundlagen, Empfehlungen und Regelwerke.
An die Qualität des Trinkwassers werden hohe Anforderungen gestellt: Da Krankheitserreger, wenn sie ins Trinkwassernetz gelangen würden, rasch viele Menschen erreichen und infizieren könnten, muss dieses Risiko sehr gering gehalten werden. Stoffe, die ins Trinkwasser gelangen, wären wir gegebenenfalls ein Leben lang täglich ausgesetzt. Deshalb gilt es, „Fremdstoffe“ aus dem Trinkwasser herauszuhalten – so weitgehend wie möglich und vorsorglich auch für solche, durch die bislang keine Gesundheitsrisiken bekannt sind.
Barrieren gegen Verunreinigung sind in der gesamten Prozesskette wichtig – beim Gewinnen, beim Aufbereiten und beim Verteilen des Trinkwassers: Ist die Ressource gut geschützt, ist weniger technische Aufbereitung notwendig. Werden Verteilungssysteme nach den technischen Regeln gebaut, gewartet und betrieben, so entstehen darin keine Verunreinigungen durch Abgabe von Substanzen aus den Werkstoffen oder durch das Wachstum von Legionellen. Entscheidend für die Trinkwasserqualität ist daher das Management der Systeme. Dafür tragen die Betreiber die Verantwortung – also Wasserversorger und Eigentümer beziehungsweise Betreiber von Gebäuden. Die staatliche Überwachung erfolgt durch die Gesundheitsämter in der Verantwortung der Länder und Kommunen.
Nach den §§ 45 und 46 der TrinkwV haben Betreiber (Wasserversorger) einer zentralen oder dezentralen Wasserversorgungsanlage den betroffenen Anschlussnehmern mindestens jährlich geeignetes und leicht verständliches Informationsmaterial über die Beschaffenheit des Trinkwassers in Textform zu übermitteln.
Weiterhin finden die Verbraucher auf der Homepage des Wasserversorgers alle gesetzlich vorgeschriebenen Informationen.
Daneben hat der Betreiber (Wasserversorger) über eine Internetseite die Verbraucher in benutzergerechter Weise unter anderem über die Wasserhärte zu informieren. Weiterhin können der Internetseite Gesundheits- und Gebrauchshinweise im Hinblick auf das Trinkwasser, wenn das Gesundheitsamt oder die zuständige Behörde den Betreiber (Wasserversorger) darüber unterrichtet hat, dass eine Schädigung der menschlichen Gesundheit zu besorgen ist oder dass ein Risiko für die menschliche Gesundheit besteht, entnommen werden.
Der Verbraucher kann über die Internetseite weiterhin Informationen über das Riskmanagement der Wasserversorgungsanlage, sowie Empfehlungen zur Verringerung der Menge des verbrauchten Trinkwassers und zum sonstigen verantwortungsvollen Umgang mit Wasser entsprechend der Gegebenheiten an dem Ort, an dem das Trinkwasser bereitgestellt oder abgegeben wird, und zur Vermeidung einer Schädigung der Gesundheit durch stagnierendes Trinkwasser entnehmen.
Trinkwasserverordnung
Die Grenzwerte der Parameter, Begriffsbestimmungen, sowie die Schutzvorschriften für das Trinkwasser sind in der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) geregelt.
2023 ist die neue Trinkwasserverordnung (TrinkwV) in Kraft getreten.
Hauptsächliche Änderungen sind unter anderem:
- die Einführung der verpflichtenden Risikobewertung und des Risikomanagements für die komplette Versorgungskette vom Einzugsgebiet bis zum Verbraucher
- Prüfung durch das Gesundheitsamt, ob das Risikomanagement und der daraus abgeleitete Untersuchungsplan den Anforderungen entsprechen und vollständig sind
- neue Anforderungen bei Untersuchungspflichten und dem Untersuchungsplan
- neue Qualitätsparameter wie z. B. somatische Coliphagen, Microcystin-LR, PFAS und Bisphenol A
- Verschärfungen bei Parametern wie Blei, Chrom und Arsen
- verpflichtender Austausch oder Stilllegung von Bleirohrleitungen bis 12. Januar 2026 in allen Wasserversorgungsanlagen inklusive Trinkwasserinstallationen
- neue Informationspflichten der Betreiber
Unsichtbare Gefahr Blei
Das Trinkwasser in älteren Häusern mit Wasserrohren aus Blei kann erhöhte Bleigehalte aufweisen und dadurch Ihre Gesundheit gefährden. Dies ist insbesondere der Fall, wenn das Wasser längere Zeit in Bleirohren gestanden hat (z. B. über Nacht). Gesundheitlich bedeutend ist vor allem die schleichende Belastung durch regelmäßige Aufnahme kleiner Bleimengen. Sie beeinträchtigt die Blutbildung und Intelligenzentwicklung bei Ungeborenen, Säuglingen und Kleinkindern. Besonders empfindlich auf Blei reagiert das sich entwickelnde kindliche Nervensystem. Beim Erwachsenen wird Blei ausgeschieden oder in den Knochen eingelagert. Es kann von dort aber wieder ins Blut gelangen (z. B. während der Schwangerschaft).
Bleileitungen erkennen
Um festzustellen, ob sich noch Bleileitungen in Ihrem Haus befinden, sind folgende Maßnahmen hilfreich:
- Kontrollieren Sie sichtbare Leitungen (z. B. im Keller vor und hinter dem Wasserzähler). Bleileitungen sind im Gegensatz zu Kupfer- oder Stahlleitungen weicher. Sie lassen sich mit einem Messer leicht einritzen oder abschaben und erscheinen silbergrau.
- Fragen Sie bei Ihrem Vermieter, Hausverwalter oder Hauseigentümer nach, wann die Wasserleitungen installiert wurden und aus welchem Werkstoff sie sind.
- Im Zweifelsfall kann eine fachgerechte Labormessung Aufschluss über die Bleibelastung des Trinkwassers geben. Solche Messungen sind jedoch kostenpflichtig. Lassen Sie vor der Probenentnahme das Wasser mindestens vier Stunden in der Leitung stehen.
Bleihaltiges Wasser nicht trinken
Verwenden Sie (möglicherweise) bleibelastetes Wasser nicht als Trinkwasser oder zur Zubereitung von Speisen. Für schwangere Frauen, Säuglinge und Kinder bis zum sechsten Lebensjahr ist Wasser aus Bleirohren als Trinkwasser immer ungeeignet. Verwenden Sie stattdessen in solchen Fällen abgepacktes Wasser mit dem Aufdruck „Geeignet für die Zubereitung von Säuglingsnahrung“. Die Anwendung von Filtern zur Bleientfernung ist nicht sinnvoll.
- Unabhängig von einer möglichen Bleibelastung sollten Sie nach längerer Standzeit das erste Wasser aus der Leitung nicht für die Ernährung verwenden. Lassen Sie das Stagnationswasser ablaufen, bis es kühl aus der Leitung läuft.
- Wenn eine Überschreitung des Grenzwertes im Trinkwasser festgestellt wird, muss Abhilfe – letztlich durch das Entfernen der Bleileitungen – geschaffen werden. Bis dahin ist eine äußerliche Anwendung des Wassers zur Körperpflege aus gesundheitlicher Sicht noch möglich.
Bleileitungen nicht mehr zulässig
Die am 24.06.2023 in Kraft getretene, novellierte Trinkwasserverordnung sieht ein Verbot von Bleileitungen vor. Demnach sind bis zum 12.01.2026 alle Bleileitungen und auch Teilstücke zu entfernen oder stillzulegen. Auch kleinere Teilabschnitte aus Bleileitungen können in Kombination mit anderen metallenen Werkstoffen zu hohen Bleigehalten im Wasser führen. Deshalb ist beim Austausch von Bleileitungen darauf zu achten, dass diese vollständig ausgetauscht werden und eine Entfernung auch von Teilstücken ist zwingend notwendig.Legionellen
Legionellen sind Krankheitserreger, die natürlicherweise in einer feuchten Umwelt und damit auch im Trinkwasser vereinzelt vorkommen können. Insbesondere in größeren, nicht ordnungsgemäß betriebenen Hausinstallationen kann beim Duschen die Gefahr bestehen, über kleinste Wassertropfen (Aerosole) Legionellen in die Atemwege aufzunehmen. Dies kann schwere Lungenentzündungen verursachen. Nähere Informationen über das Vorkommen und Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellenwachstum erhalten Sie auf den Internetseiten des Niedersächsischen Landesgeundheitsamtes (NLGA).
Schwimm- und Badebeckenwasser
Das Schwimm- und Badebeckenwasser in öffentlichen Schwimmbädern, in Gewerbebetrieben und in sonstigen nicht ausschließlich privat genutzten Einrichtungen wird durch die örtlichen Gesundheitsbehörden hygienisch überwacht. Sie stellen damit sicher, dass Gesundheitsgefahren, insbesondere durch Krankheitserreger, beim Baden und Schwimmen vermieden werden.
Badegewässer
Jedes Jahr ab Ende April bis zum Ende der Badesaison (15.05.-15.09.) entnehmen die örtlichen Gesundheitsbehörden mindestens alle vier Wochen Wasserproben aus den ca. 280 niedersächsischen Badegewässern und prüfen diese auf bakterielle Belastungen. Dabei werden die Badestellen im Rahmen einer Ortsbesichtigung auch auf sichtbare Verschmutzungen kontrolliert.
Die hygienische Güte der Badegewässer unterliegt gewissen Schwankungen und die Messungen stellen Momentaufnahmen dar. Aus der Bewertung des Ergebnisses einer einzelnen Probe / Untersuchung kann daher nicht auf die generelle hygienische Güte der Wasserqualität an einer Badestelle geschlossen werden. Eine Gesamtbewertung und Einstufung in Qualitätskategorien von „ausgezeichnet“ bis „mangelhaft“ werden für jede Badestelle auf der Basis der Untersuchungsergebnisse von 4 Jahren vorgenommen. Die ganz überwiegende Mehrzahl der niedersächsischen Badegewässer ist als gut oder sogar ausgezeichnet eingestuft. Kein Badegewässer ist als mangelhaft eingestuft.
Umfassende Informationen zu den niedersächsischen Badegewässern mit aktuellen Untersuchungsergebnissen gibt es im Internet auf den Seiten des Niedersächsischen Badegewässeratlas unter der Adresse www.badegewaesseratlas.niedersachsen.de.

Foto: Im Vordergrund Wasserflaschen, im Hintergund sitzt eine Person in einem weißen Kittel
Informationen zu
gesundheitlichen Fragen