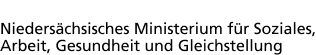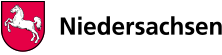Antwort auf die mündliche Anfrage: Reduzierung der Emissionen an Biogas-BHKWs
Hannover. Niedersachsens Sozialministerin Cornelia Rundt hat namens der Landesregierung auf eine mündliche Anfrage der Abgeordneten Renate Geuter (SPD) geantwortet:
Die Abgeordnete Renate Geuter hatte gefragt:
Maßnahmen zur Reduzierung der Emissionen an Biogas-BHKWs - Welche Grenzwerte sind einzuhalten, und wie wird das kontrolliert?
Nach den Angaben im aktuellen Potenzialatlas „Bioenergie" erreichen bestimmte Landkreise in Niedersachsen deutschlandweit die höchste Dichte an Biogasanlagen. In diesen Regionen spielt nicht nur die Frage der Nutzungskonkurrenzen bzw. die ordnungsgemäße Verbringung der Gärreste eine wichtige Rolle, sondern auch die Entwicklung möglicher Emissionen aus der Biogasanlage.
Blockheizkraftwerke sind die zentrale Einheit einer Biogasanlage und die wichtigste Komponente bei der Verstromung des produzierten Biogases. Bei der Verbrennung methanreicher Gase können jedoch auch erhebliche Mengen schadstoffrelevanter Abgase entstehen. Um die Emissionen aus der Verstromung möglichst gering zu halten, enthält die TA Luft Emissionsgrenzwerte. Diese Grenzwerte beziehen sich auf BHKWs mit einer Feuerungswärmeleistung von mehr als 1 MW, die einer Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz bedürfen. Kleinere, dem Baurecht unterliegende Anlagen müssen dem Stand der Technik genügen. In diesem Fall gibt es zwar keine gesetzlich bindenden Grenz-, jedoch Richtwerte, die sich an den Vorgaben der TA Luft orientieren und die auch als Grundlage zur Genehmigung von Biogasanlagen herangezogen werden.
Eine Vorgabe, die Schadstoffemissionen (insbesondere Formaldehyd) im Abgas der Biogasanlage regelmäßig überprüfen zu lassen, besteht ebenfalls nur bei Anlagen, die nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigt worden sind. Ein großer Anteil der in Niedersachsen vorhandenen Anlagen ist allerdings von dieser Regelung nicht erfasst.
Ich frage die Landesregierung:
1. Welche Regelungen gelten in Niedersachsen zur Begrenzung von Emissionen aus Biogas-BHKWs für Anlagen, die lediglich nach dem Baurecht zu genehmigen sind?
2. Werden auch für diese Anlagen regelmäßige Überprüfungen der Schadstoffemissionen der BHKWs vorgeschrieben und, wenn ja, in welchen Fällen?
3. Hält die Landesregierung weitergehende Maßnahmen zur Reduzierung insbesondere der Formaldehydemissionen an Biogas-BHKWs für erforderlich und, wenn ja, welche?
Ministerin Cornelia Rundt beantwortete die Anfrage namens der Landesregierung:
Nach Nr. 1.4.1 des Anhangs der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212, 250) bedürfen Verbrennungsmotoranlagen für den Brennstoff Biogas nur ab einer Feuerungswärmeleistung von einem Megawatt einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung. Gemäß Nr. 2.4 des Anhangs zur Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) i. V. m. § 2 Abs. 5 Satz 2 NBauO ist die Errichtung von Blockheizkraftwerken (BHKW) verfahrensfrei, d. h. sie bedarf auch keiner Baugenehmigung, soweit die BHKW nicht nach dem Bundes–Immissionsschutzgesetz (BImSchG) genehmigungsbedürftig sind. Danach ist also bei BHKW mit einer Feuerungswärmeleistung unter einem Megawatt, die mit Biogas betrieben werden, weder eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung noch eine Baugenehmigung erforderlich.
Gemäß § 22 BImSchG sind nicht genehmigungsbedürftige Anlagen so zu errichten und zu betreiben, dass
1. schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind,
2. nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden und
3. die beim Betrieb der Anlagen entstehenden Abfälle ordnungsgemäß beseitigt werden können.
Das Immissionsschutzrecht stellt an nicht genehmigungsbedürftige Anlagen deutlich geringere Anforderungen als an genehmigungsbedürftige Anlagen. So treffen die Betreiber genehmigungsbedürftiger Anlagen insbesondere die sogenannten dynamischen Grundpflichten nach § 5 Abs. 1 BImSchG. Hervorzuheben sind hierbei die Vorgaben, dass schädliche Umwelteinwirkungen durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage nicht hervorgerufen werden dürfen und Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen zu treffen ist. Diese Pflichten sind dynamisch, weil sich das Maß der zu erfüllenden Anforderungen grundsätzlich nach dem Fortschritt des Technikstandes richtet.
Betreiber nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen haben demgegenüber gemäß § 22 BImSchG schädliche Umwelteinwirkungen nur insoweit zu verhindern, als diese nach dem Stand der Technik vermeidbar sind bzw. unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf das nach dem Stand der Technik mögliche Mindestmaß zu begrenzen. Eine Pflicht zur Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen trifft sie hingegen grundsätzlich nicht, es sei denn, eine solche Pflicht wäre durch eine spezielle immissionsschutzrechtliche Verordnung auch gegenüber dem Betreiber einer nicht genehmigungsbedürftigen Anlage angeordnet.
Während auch bei nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen die in Nr. 4 der Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) festgelegten Grundsätze zur Ermittlung und Beurteilung von schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionswerte) herangezogen werden sollen, gelten die emissionsbegrenzenden Anforderungen nach Nr. 5 der TA Luft für diese Anlagen nicht und können auch nicht mittelbar herangezogen werden, weil sie der Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen dienen.
Aufgrund einer Änderung der Anlage zur 4. BImSchV sowie der Neufassung dieser Verordnung durch Artikel 1 der Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie über Industrieemissionen, zur Änderung der Verordnung über Immissionsschutz- und Störfallbeauftragte und zum Erlass einer Bekanntgabeverordnung vom 2. Mai 2013 (BGBl. I S. 973) sind in erheblichem Umfang bislang nicht genehmigungsbedürftige Biogasanlagen der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungspflicht unterworfen worden. Soweit die betroffenen Anlagen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Rechtsänderung bereits errichtet waren, sind sie der zuständigen Immissionsschutzbehörde innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten der Änderung anzuzeigen. Für sie gelten nunmehr sämtliche immissions- und emissionsbezogenen Anforderungen an immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige Anlagen.
Anforderungen zur Emissionsbegrenzung im Hinblick auf Staub, gasförmige anorganische Stoffe, organische Stoffe, krebserzeugende, erbgutverändernde oder reproduktionstoxische Stoffe etc., die grundsätzlich für alle immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Anlagen gelten, enthält Kapitel 5.2 der TA Luft. Für bestimmte Anlagenarten sind im Kapitel 5.4 der TA Luft spezifische Emissionsbegrenzungen festgelegt, die nur für die jeweilige Anlagenart vorrangig gelten. Für Verbrennungsmotoranlagen, in denen Biogas zur Erzeugung von Strom eingesetzt wird, sind die emissionsbegrenzenden Anforderungen der Ziffer 5.4.1.4 einschlägig. Dort wird beispielsweise für Formaldehyd ein Grenzwert von 60 mg/m³ vorgegeben.
Grundsätzlich gelten diese Anforderungen nicht für die nicht immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Anlagen. Die Vorsorgeanforderungen der TA Luft können aber unter bestimmten Voraussetzungen, wie z. B. eine besondere Immissionssituation, als Erkenntnisquelle für die Bauherren, Betreiber oder für verwaltungsrechtliche Entscheidungen im Einzelfall herangezogen werden.
Bezüglich Formaldehyd ist in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe zum Immissionsschutz ‑ LAI - ferner ein Beschluss gefasst worden, dass die Voraussetzung für die Gewährung einer im Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) verankerten Zusatzvergütung bei biogasbetriebenen Verbrennungsmotoranlagen u. a. ein maximaler Emissionswert von 40 mg/m³ (bezogen auf 5% O2) im Abgas ist.
Neben den immissionsschutzrechtlichen Vorschriften verlangt § 13 der NBauO ganz allgemein, dass bauliche Anlagen, zu denen auch BHKW zählen, u. a. so beschaffen sein müssen, dass Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. Konkrete emissions- oder immissionsbezogene Vorschriften und Grenzwerte existieren im Bauordnungsrecht nicht. Es kann auch nicht dort ergänzend herangezogen werden, wo bundesrechtliche Vorschriften des Immissionsschutzes unterhalb bestimmter Schwellenwerte keine Regelungen getroffen haben.
Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen namens der Landesregierung wie folgt:
Zu 1:
Es wird auf die Vorbemerkungen verwiesen.
Zu 2:
Nein.
Zu 3:
Seitens der Landesregierung wird derzeit kein Handlungsbedarf gesehen.

Artikel-Informationen
erstellt am:
31.05.2013
Ansprechpartner/in:
Frau Heinke Traeger