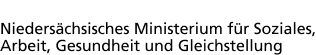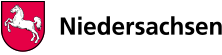Bildrechte: Land Niedersachsen
Bildrechte: Land NiedersachsenWas macht unsere Nachbarschaften lebenswert? Wie müssen Wohnquartiere aufstellt sein, damit die Menschen in ihrer Umgebung gut leben? Sozialministerin Cornelia Rundt spricht zur "Zukunft im Quartier" auf dem 11. Demografie-Kongresses „Best A
- Es gilt das gesprochene Wort! -
„Unter dem Motto „Die Zukunft liegt im Quartier“ versucht der diesjährige Demografie-Kongress die Quartierslebenswelten von allen Seiten zu beleuchten. Viele Faktoren haben Auswirkung auf die Quartiere.
Städtebauförderung
Die Städtebauförderung ist für die niedersächsische Landesregierung von großer Bedeutung. Sie ist ein zentrales Instrument für die regionale Entwicklung. Mit Hilfe der Fördermittel, die für die mittlerweile fünf unterschiedlichen Programme zur Verfügung gestellt werden, können die Kommunen die Herausforderungen des demografischen und wirtschaftlichen Strukturwandels oder der militärischen Konversion bewältigen und vor allem die Lebensbedingungen in sozial benachteiligten Quartieren verbessern.
Niedersachsen stellt aus diesen Gründen auch im Programmjahr 2016 für die Städtebauförderung Landesmittel in erheblicher Höhe zur Verfügung, so dass die Bundesmittel in voller Höhe gegenfinanziert werden. Auch in den kommenden Jahren strebt die Landesregierung eine vollständige Gegenfinanzierung an.
Im Programmjahr 2016 werden insgesamt Fördermittel (Bundes- und Landesmittel) in Höhe von rund 89,3 Mio. Euro bereitgestellt, die in die fünf Förderprogramme „Soziale Stadt“. „Stadtumbau West“, „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ „Städtebaulicher Denkmalschutz“ und „Kleinere Städte und Gemeinden“ fließen.
Ein besonderer Schwerpunkt der Förderung in Niedersachsen ist auch in diesem Jahr das Programm „Soziale Stadt“. Als Leitprogramm der sozialen Integration in der Stadterneuerung trägt es in besonderem Maße dazu bei, Stadt- und Ortsteile, die städtebaulich und auch wirtschaftlich benachteiligt sind, zu stabilisieren und aufzuwerten. Das stärkt dort den sozialen Zusammenhalt in diesen Quartieren und kommt den Menschen, die dort wohnen, unmittelbar zugute.
Soziale Wohnraumförderung in Niedersachsen
Wir stehen aktuell vor der großen Aufgabe, ausreichend bezahlbaren Wohnungsangebote für die Menschen in Niedersachsen zu schaffen. Denn vielerorts fehlt es an bezahlbarem Wohnraum. Das betrifft insbesondere unsere Großstädte, die Universitätsstädte und die wirtschaftlich starken Regionen. Für diese Entwicklung gibt es verschiedene Gründe. Ein Grund dafür ist, dass wir derzeit eine neue Welle der Urbanisierung erleben: Die Menschen zieht es wieder in die Städte. Die Städte versprechen Arbeitsplätze und eine gute Versorgung.
Neben diesen inneren Wanderungsbewegungen stand unser Land im letzten Jahr unter dem Eindruck einer erheblichen Zuwanderung von außen. Mehr als 100.000 Flüchtlinge sind allein im letzten Jahr nach Niedersachsen gekommen. Auch für diese Menschen muss neuer, preisgünstiger Wohnraum geschaffen werden. Insgesamt müssen wir heute feststellen, dass die Neubautätigkeit viele Jahre unter dem eigentlich benötigten Niveau lag.
Dazu haben eine gute Konjunktur, steigende Beschäftigung und höhere Einkommen in den letzten Jahren zu einer größeren individuellen Wohnflächennachfrage geführt. Die Folgen sind steigende Mieten und Preise.
Schließlich kommen noch demografische Veränderungen hinzu. Der demografische Wandel hat nach Schätzungen zur Folge, dass in Deutschland im Jahr 2030 zusätzlich rund drei Millionen Wohnungen und Häuser von der Generation 65Plus bewohnt werden. Daraus ergibt sich ein immenser Bedarf an altersgerechten und barrierefreien Wohnungen.
Diesen Wohnraum zu schaffen, ist eine der vordringlichsten Aufgaben für die kommenden Jahre, denn das Angebot reicht derzeit nicht aus. Das führt dazu, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben, eine angemessene Wohnung zu finden, sei es wegen ihres geringen Einkommens, oder weil sie andere Zugangsprobleme haben, z. B. Alleinerziehende oder mobilitätseingeschränkte Menschen und schlichtweg einfach nicht genügend geeignete Wohnungen bereit stehen.
Dabei haben wir bereits Fortschritte erzielt. Mit dem Wohnungsbau in Deutschland und auch in Niedersachsen geht es seit einigen Jahren wieder bergauf. Die Zahl der Fertigstellungen ist kontinuierlich angestiegen. Ein großer Anteil fällt auf den Geschosswohnungsbau. Das ist eine sehr gute Nachricht. Unser Ziel ist es, das alle Menschen in Niedersachsen in würdigen Verhältnissen wohnen und leben können. Und dies zu einem Preis, den sich auch Menschen mit kleinen Einkommen leisten können. Ich will nicht, dass es bei uns so weit kommt, dass Menschen mit kleinen oder mittleren Einkommen aus den Stadtzentren gedrängt werden, weil sie sich die Mieten dort nicht mehr leisten können. Es darf auch nicht dazu kommen, dass Quartiere entstehen, in denen nur Menschen mit kleinen Einkommen wohnen und leben. Wir brauchen vielmehr Quartiere, in denen sich Menschen begegnen und zusammen leben, die in jeder Hinsicht durchmischt sind, ob das nun ihre Herkunft oder ihr Einkommen betrifft.
Unsere soziale Wohnraumförderung ist dafür ein sehr wichtiges Instrument. Mit ihr werden insbesondere einkommensschwächere Haushalte und Menschen unterstützt, die sich nicht aus eigener Kraft mit angemessenem Wohnraum versorgen können. Bereits im letzten Jahr haben wir das Wohnraumförderprogramm um 400 Millionen Euro aufgestockt. Und die gute Nachricht ist: Auch der Bund will noch einmal draufsatteln. Im Rahmen des Integrationspaketes hat er den Ländern für die Jahre 2017 und 2018 je weitere 500 Millionen Euro zugesagt. Bis 2019 stehen damit insgesamt mehr als 800 Millionen Euro für die Wohnraumförderung zur Verfügung. Das ist eine gute Nachricht für uns und alle Menschen in Niedersachsen, die auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen sind. Damit können wir noch mehr Wohnungen fördern, die gezielt für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen bereitstehen. Mit den zusätzlichen Bundesmitteln werden wir für das nächste Jahr eine Zuschussförderung einführen, um noch einen weiteren Anreiz für die Investition in den sozialen Wohnungsbau zu setzen.
Bedeutung sozialer Quartiere
Für die Menschen ist ihr Quartier, ihr Viertel, ihre Nachbarschaft ein wichtiger Teil ihres Lebens. Auf engem Raum treffen hier Menschen unterschiedlicher Altersstufen, in unterschiedlichen Lebenssituationen und mit unterschiedlichem kulturellem und sozialem Hintergrund aufeinander, die häufig über hoch differente Entwicklungs- und Teilhabechancen verfügen. Abhängig davon, wie dieses konkrete Lebensumfeld - sprich die Wohnung selbst und das direkte Wohnumfeld, die Verkehrsanbindung, das Nahversorgungsangebot und das kulturelle Angebot, aber natürlich auch die gesundheitliche und pflegerische Infrastruktur vor Ort - ausgestaltet ist, unterscheiden sich diese Entwicklungs- und Teilhabechancen massiv.
Pflegebedürftigkeit
Gerade in der Phase des Alters und der Pflegebedürftigkeit spielt das Quartier eine wichtige Rolle. Je älter ein Mensch ist, desto größer ist das Risiko, pflegebedürftig zu werden und auf die Unterstützung angewiesen zu sein, um den Alltag noch zu bewältigen. Ältere und pflegebedürftige Menschen sind besonders davon abhängig, dass Einkaufsmöglichkeiten und Arztpraxen fußläufig oder doch zumindest mit dem Nahverkehr erreichbar sind, Bürgersteige eine Absenkung haben, so dass sie auch mit einem Rollator befahren werden können, barrierefreie Wohnangebote bestehen und ambulante Pflegedienste auch in ihrem Quartier noch genügend Fachkräfte haben, um neue Patientinnen und Patienten anzunehmen.
Diese Voraussetzungen sind elementar dafür, um auch im Alter und bei Pflegebedürftigkeit im vertrauten Umfeld bleiben zu können. Dies entspricht dem Wunsch der meisten Menschen und ist gleichzeitig Ausdruck des Prinzips „ambulant vor stationär“, das ja eines der zentralsten Gestaltungsgrundsätze der Pflegeversicherung darstellt.
Gesundheitsregionen
Es bedarf eines koordinierten und vernetzten Zusammenwirkens unterschiedlichster Akteure. Ich denke hierbei natürlich an die Kommunen, die Verantwortung für die Sicherstellung der sozialen Daseinsvorsorge tragen. Aber auch viele andere Akteure, wie zum Beispiel die Wohnungswirtschaft vor Ort, die Leistungsanbieter von Pflege und pflegeflankierenden Angeboten, das medizinische Versorgungssystem, die Wirtschaftsförderung und nicht zuletzt auch die Akteure der Selbstverwaltung und Politik stellen hierbei wichtige Weichen.
Bei uns in Niedersachsen haben wir an dieser Stelle sehr gute Erfahrungen mit dem landesweiten Aufbau von „Gesundheitsregionen“ gesammelt. 70 % unserer Landkreise und kreisfreien Städte beteiligen sich mittlerweile an diesem Programm, das durch das Land Niedersachsen, die AOK Niedersachsen, die Ersatzkassen, die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen und den BKK Landesverband Mitte gefördert wird.
Das Programm sieht vor, dass sich in allen beteiligten Landkreisen und kreisfreien Städten regionale Steuerungsgruppen bilden, die in regelmäßigen Abständen tagen. Hierin vertreten sind die Verwaltungsspitze, Vertretungen der örtlichen Krankenhäuser und der Ärzteschaft, der ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen, der Krankenkassen vor Ort, der Kassenärztlichen Vereinigung aber auch andere Akteure, zum Beispiel die Selbsthilfe oder die Wohnungswirtschaft.
Aufgabe der Steuerungsgruppe ist es, die sozialen und gesundheitlichen Belange der Bürgerinnen und Bürger vor Ort in den Blick zu nehmen. Sie analysiert, an welcher Stelle sich die regionalen Gegebenheiten verändern müssen, um im direkten räumlichen Umfeld der Menschen gesundheitsförderliche Lebensbedingungen zu schaffen und die Gesundheitsversorgung bedarfsgerecht und wohnortnah zu gestalten. In Arbeitsgruppen werden dann konkrete Maßnahmen und Projekte entwickelt, die diese Handlungsfelder aufgreifen.
In den letzten zwei Jahren haben die beteiligten Gesundheitsregionen auf diese Art und Weise viele erfolgsversprechende Ansätze erarbeitet. Sie tragen dazu bei, Quartiere angepasst an die gesundheitlichen und sozialen Bedürfnisse der hier Lebenden zu gestalten.
Beispielsweise wurde in der Gesundheitsregion Lüneburg der sogenannte „Lüneburger Alterslotse“ entwickelt. Dieser unterstützt ältere Menschen dabei, sich in dem immer komplexer werdenden Gesundheitssystem zurechtzufinden. Die Lotsen halten umfangreiche Informationen zu Gesundheitsbelangen und das Leben im Alter vor und begleiten die Ratsuchenden über einen längeren Zeitraum.
Einen ganz anderen Ansatz verfolgen beispielsweise die Gesundheitsregionen Hannover und Wolfenbüttel. Hier werden zurzeit demenzfreundliche Kommunen aufgebaut. Ziel ist, die Kommune als sozialen Raum so zu gestalten, dass Menschen mit Demenz und ihre Familien hier gut leben können. Ihnen soll hierdurch eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht werden.
Durch die umfassende Vernetzungs- und Kooperationsarbeit, die in den Gesundheitsregionen geleistet wird, lässt sich sehr viel bewegen. Dies kommt insbesondere auch älteren und pflegebedürftigen Menschen zugute.
Durchweg positiv sind in Niedersachsen auch die Erfahrungen mit der kommunalen Beratungsstruktur der Senioren- und Pflegestützpunkte. Dort erfolgt die Beratung von Seniorinnen und Senioren mit oder ohne Pflegebedürftigkeit aus einer Hand. Die Senioren- und Pflegestützpunkte bauen neben ihrer Beratungstätigkeit auch lokale Netzwerke von ehrenamtlichen, nachbarschaftlichen und professionellen Anbietern auf. Und sie sind wichtige Impulsgeber für die Entwicklung innovativer Angebote. Dafür möchte ich Ihnen ein Beispiel geben. Der Senioren- und Pflegestützpunkt Celle hat eine Telefonkette insbesondere für alleinstehende Seniorinnen und Senioren, die zurückgezogen leben und in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, ins Leben gerufen. Dieser niedrigschwellige Telefonkontakt „Guten Morgen“ hat über morgendliche gegenseitige Anrufe dazu geführt, dass die Beteiligten angefangen haben, sich untereinander selbstorganisiert regelmäßig zu treffen.
Der Ansatz der Senioren- und Pflegestützpunkte sowie der Gesundheitsregionen zeichnet sich gerade dadurch aus, dass den Kommunen im Umsetzungsprozess eine zentrale, koordinierende und steuernde Rolle zukommt.
Stärkung der ambulanten Pflege
Neben einem übergreifenden Vernetzungsansatz und einer starken Rolle der Kommunen ist es für eine gelungene Quartiersarbeit aber auch wichtig, zentrale in den Quartieren versorgende Akteure gezielt zu stärken. Auch hier kann Landespolitik wichtige Weichen stellen. Eine herausragende Rolle nehmen dabei zum Beispiel die ambulanten Pflegedienste ein. Sie leisten vor Ort exzellente Arbeit und tragen maßgeblich dazu bei, Menschen mit körperlichen und kognitiven Einschränkungen den Verbleib in ihrem gewohnten Lebensumfeld zu ermöglichen. In den letzten Jahren hat es eine enorme Steigerung der Nachfrage nach ambulanten Pflegeleistungen gegeben. Allein in Niedersachsen hat sich die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger dieser Leistungsform seit dem Jahr 1999 von etwa 70.000 auf mehr als 100.000 Personen im Jahr 2013 vergrößert. Bundesweit zeigen sich ähnliche Trends.
In Niedersachsen, aber auch in vielen anderen Regionen Deutschlands beobachten wir mittlerweile mit Sorge, dass dieser gesteigerten Nachfrage oft gar nicht mehr begegnet werden kann. Die Pflege-Thermometer-Befragung des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung belegt das ganz deutlich: Bereits 30 % der befragten Pflegedienste mussten in den letzten Jahren Kundenanfragen ablehnen.
Ursache ist der Personalmangel, der insbesondere in ambulanten Pflegediensten mittlerweile vielerorts sehr deutlich zutage tritt. Die häusliche Versorgung der Pflegebedürftigen ist unter diesen Bedingungen oft massiv gefährdet.
Gerade in den ländlichen Regionen sind die Folgen des demografischen Wandels häufig besonders spürbar. Hinzu kommt insbesondere in strukturschwachen ländlichen Gebieten eine Abwanderung junger Menschen, die potenziell in den Pflegediensten beschäftigt sein könnten, oder als Angehörige Unterstützung leisten könnten. Die häufig unzureichende Vergütung, geteilte Dienste, erzwungene Teilzeitarbeit und die Arbeitsverdichtung tun ihr Übriges und verschärfen die personelle Situation in den ambulanten Diensten noch zusätzlich.
In Niedersachsen sehen wir hier dringende Handlungsbedarfe, denen wir entschieden begegnen müssen. Hierzu ergreifen wir unterschiedliche Maßnahmen. Beispielsweise hat die Niedersächsische Landesregierung zum 01. Juli 2016 das Förderprogramm „Stärkung der ambulanten Pflege im ländlichen Raum“ aufgelegt. Für einen Zeitraum von drei Jahren werden jährlich mehr als 6 Millionen Euro eingesetzt, um die Arbeits- und Rahmenbedingungen in der ambulanten Pflege in ländlichen Regionen Niedersachsens nachhaltig zu verbessern. Pflegedienste, die ihre Beschäftigten entweder tarifgebunden oder tarifgerecht entlohnen, können eine Förderung von bis zu 45.000 Euro pro Dienst und Kalenderjahr in Anspruch nehmen. Hiermit können sie Maßnahmen und Projekte in den vier Schwerpunktbereichen „Verbesserung der Arbeits- und Rahmenbedingungen, „Kooperation und Vernetzung“, „Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ oder „Einführung von technischen und EDV-gestützten Systemen“ umsetzen.
Die Beschränkung auf tarifgerecht oder tarifgebunden entlohnende Pflegedienste stellt dabei ein wichtiges Gestaltungselement des Förderprogramms dar. Hierdurch wird eine maßgebliche pflegepolitische Zielsetzung des Landes unterstrichen: die Sicherung eines angemessenen Einkommensniveaus in Niedersachsen. Diesem Thema widmen wir uns in Niedersachsen aus gutem Grund mit Nachdruck.
Förderprogramm „Wohnen und Pflege im Alter“
Um Quartiere alters- und pflegegerecht zu gestalten, muss aber auch Wohnraum vorhanden sein, der an die besonderen Bedarfe dieses Personenkreises angepasst ist. Mit dem Förderprogramm „Wohnen und Pflege im Alter“ fördern wir sowohl investive als auch nicht investive Projekte, die ein weitestgehend selbständiges Leben älterer Menschen in einem häuslichen Wohnumfeld auch bei zunehmenden Einschränkungen ermöglichen.
Gefördert werden insbesondere die Schaffung alters- und pflegegerechter Wohnumfeldbedingungen einschließlich der erforderlichen Beratungsstrukturen und die Entwicklung von Handlungsstrategiegen zum Aufbau von Netzwerken im Quartier. Im Haushalt des Niedersächsischen Sozialministeriums stehen jährlich 1 Million Euro für das Förderprogramm „Wohnen und Pflege im Alter“ bereit. Besonders erfreulich ist das große Interesse an diesem Förderprogramm, so dass 19 Projekte im Jahr 2015 und 15 Projekte im Jahr 2016 eine Förderung erhalten konnten.
Schlusswort
Um lebenswerte Quartiere zu schaffen, in denen Bewohnerinnen und Bewohner mit niedrigem, mittleren und höherem Einkommen, Familien mit Kindern, Paare und Singles, Einheimische und Zugezogene und auch Menschen in herausfordernden Lebenssituationen, zum Beispiel Pflegebedürftigkeit, leben und sich wohlfühlen können, bedarf es einer ganzheitlichen Quartierspolitik. Wir müssen unsere Kräfte bündeln und den Handlungsspielraum nutzen, der uns dadurch gegeben ist. Stadtentwicklung, Wohnungsbau, soziale Projekte und gesundheitliche Versorgungsstrukturen müssen aufeinander abgestimmt sein.
Das mag in Niedersachsen einfacher sein als in anderen Bundesländern, gehören doch all die genannten Bereiche zum gleichen Ressort, grundsätzlich erforderlich ist ein abgestimmtes Vorgehen aber überall. Nur so kann es gelingen, den Herausforderungen zu begegnen und die Schätze zu heben, die in unserer alternden Gesellschaft liegen.“
 Bildrechte: Land Niedersachsen
Bildrechte: Land NiedersachsenArtikel-Informationen
erstellt am:
08.11.2016
Ansprechpartner/in:
Dominik Kimyon